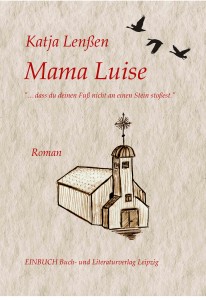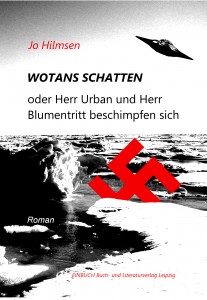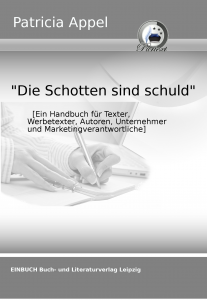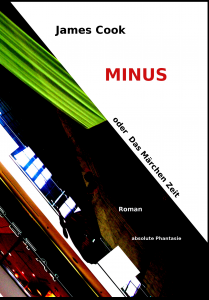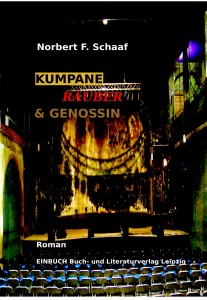REZENSIONEN, ARTIKEL, INTERVIEWS
AKTUELL
“Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel”
Tanners Interview mit Annett Leander, der Autorin von “Umarme mich – aber fass´mich nicht an!”

Annett Leander schaffte es, über all das Grauen zu schreiben. Foto: privat
Manchmal zerdrückt es einem das Herz. Beim Lesen der Autobiografie von Annett Leander war das so. Kein locker-flockiger Trendroman, kein stilbezogenes Lyriken, sondern finsterste Realität. Es ging um Missbrauch jeglicher Art an Kinderseelen und ganz speziell an der Seele und an dem Körper von Annett Leander. Tanner musste da einfach noch mal nachfragen, weil viel öfter darüber geredet werden sollte.
Liebe Annett Leander. Der Chef des Einbuch Buch- und Literaturverlags Leipzig, der Patrick Zschocher, hat mir Ihr Buch “Umarme mich – aber fass´mich bloß nicht an!” auf den Tisch gelegt. Und ich habe es gelesen. Im Untertitel steht: Eine Autobiografie, die viel zu früh geschrieben werden musste. Ich verstehe schon warum sie geschrieben werden musste. Könnten Sie bitte unseren Lesern erzählen, was das Thema so dringend machte. Auto-Biografie impliziert ja, dass es Ihre Geschichte ist.
Ich habe viel zu viele Jahre meines Lebens geschwiegen. Als Kind, aus Angst abgelehnt zu werden oder nicht glaubhaft zu erscheinen, heute bin ich erwachsen und ich bin nicht mehr in der Rolle des Kindes, aus der ich nie ausbrechen konnte. Sicherlich ist mit meinem Buch mein Leben nun nicht von vorne begonnen, aber da ich es aufschreiben konnte, habe ich mir ein großes Stück Last genommen und auch alle Menschen, die es mit Interesse lesen, werden vielleicht etwas “wachgerüttelt”. Der Missbrauch und die Gewalt an Kindern ist in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema, keiner spricht darüber und viel zu oft wird einfach weggesehen, warum kann ich allerdings nicht verstehen. Manche Menschen können sich nicht im Geringsten vorstellen, was mit einer Kinderseele passiert, wenn sie durch Demütigungen und körperliche sowie psychische Repressalien zerstört wird! Ein Leben lang hat man damit zu kämpfen.
Missbrauch an sich ist ja nicht wirklich ein Thema – außer wenn es von politischen Rattenfängern zur Postulierung von Unmenschlichkeit benutzt wird. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Gründen und Folgen findet meines Erachtens nicht statt. Sehe ich das falsch? Sie als Betroffene haben da sicher einen besseren Einblick – bewegt sich da etwas in unseren Regionen?
Da haben Sie Recht, es wird nie wirklich darüber gesprochen. In der Politik und im Bezug auf das Gesetz habe ich immer das Gefühl, es wird wie eine Lappalie behandelt. Viel zu oft bekommen Täter eine viel zu geringe Strafe, wenn überhaupt. Eine Therapieauflage oder Bewährung? Was soll das bringen? Es wird keinen Täter daran hindern, sich ein neues Opfer zu suchen.
Wenn ich in der Lage wäre, dass mein Peiniger noch am Leben wäre und angenommen er hätte im Knast gesessen und jetzt wäre der Zeitpunkt, dass er wieder entlassen werden würde, ich würde wohl in Panik ausbrechen… Die Folgen aus so einer Erfahrung verfolgen ein Opfer wohl sein Leben lang, manchmal mehr und manchmal weniger. Aber Gründe für so eine Tat sehe ich keine! Es gibt keinen Grund einen Menschen so sehr zu “beschmutzen” und zu demütigen. Egal, ob es nun um Kinder geht oder Frauen oder Männer. So etwas tut man nicht und da nach einem Grund zu suchen ist fern ab von all meinen moralischen Werten.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Ganz besonders interessiert mich da natürlich Ihr persönliches Umfeld.
Die Reaktionen auf mein Buch waren eine Mischung aus Schock, Dankbarkeit, vielleicht auch etwas Mitgefühl bis hin zu Wut … Wut über die Personen, die für mein Trauma verantwortlich sind. Natürlich bin ich sehr froh, dass ich diese Reaktionen überhaupt erlangen konnte. Meine Partnerin hat mich die ganze Zeit unterstützt und mir immer wieder die Schulter zum anlehnen gegeben, wenn ich sie brauchte, wenn mir das Schreiben und die damit verbundenen Flashbacks (Trauma-Wiedererlebungen) über den Kopf gewachsen sind. Sie ist natürlich sehr erfreut darüber, dass die Reaktionen auf mein Buch positiv ausfallen.
Ihre Geschichte muss Thema in Bildungseinrichtungen sein, eigentlich auch, um die totale Einsamkeit der Opfer zu durchbrechen. Ich dachte immer, ich wäre der einzige in meiner Klasse gewesen, der dauernd geschlagen wurde. Mir hätte es geholfen zu wissen, dass ich nicht völlig alleine bin. Heute weiß ich das. Gibt es Bestrebungen Ihrerseits mit Ihrer Geschichte aktiv aufzuklären? Ins Gespräch zu kommen? Und wenn ja, welche – wenn nicht, warum nicht?
Die Idee, in Bildungseinrichtungen mit meiner Geschichte zu gehen, finde ich sehr gut. Zur Aufklärung, aber auch um beispielsweise Lehrer auf kleine Anzeichen aufmerksam machen zu können. Des Weiteren, denke ich, wäre es wichtig, im Bereich der Sozialen Berufe anknüpfen zu können und die Personen aufmerksam zu machen, die unmittelbar in einer Rolle sind, die sich auch ganz nah an einem Opfer befinden kann. Oft muss man hinter die Fassade schauen, um wirklich zu begreifen, dass ein tieferer Grund für manch Verhaltensweise da im Verborgenen liegt.
Wie leben Sie heute? Gibt es ein Verzeihen? Ihr Vater hat nie ein Wort der Entschuldigung gesagt – wie gehen Sie damit um?
Heute lebe ich mit meiner Partnerin Sarah in einer eigenen kleinen Wohnung. Wir sind seit Februar 2012 ein Paar, auch wenn es eine Menge Unfrieden gab, haben wir uns immer wieder zusammenfinden können. Zurzeit hole ich mein Abitur nach, um im Nachhinein mal studieren zu können. Gern würde ich irgendwann im Bereich der Palliativpflege oder im Bereich Lehramt an einer Berufsschule arbeiten.
Ein Verzeihen gibt es nicht und auch habe ich wenig Interesse daran zu wissen, warum mein Erzeuger diese Dinge getan hat. Wenn ich an ihm denke und sein Gesicht in Form eines Bildes in meinen Kopf schießt, muss ich mich beherrschen, um noch klar denken zu können. Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel.
Ich selber brauchte lange, um zu verstehen, dass ich nicht schlecht bin. Wie ist Ihre ganz persönliche Selbstsicht heute? Haben Sie Wege aus der Programmierung gefunden oder suchen Sie noch?
Es ist mir noch nicht gelungen, selbst aus meinem Innersten heraus sagen zu können, dass ich selbst etwas wert bin oder dass ich gut bin, so wie ich bin. Vielleicht kann ich das aber irgendwann, ich arbeite daran.
Ich wünsche Ihnen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, liebe Annett Leander. So wie Sie sind, sind Sie gut.
Vielen Dank.
REZENSIONEN
Das Wesen des Seins: Karstens Lebensgeschichte und der „Spieler“ in seinem Kopf

Wann ist ein Leben ein Erfolg? Wann darf man am Ende des Arbeitslebens sagen: Das hat sich wirklich gelohnt? Eigentlich sind es diese Fragen, die Christian Heinisch in diesem Buch stellt, wenn er das Leben seines Helden Karsten erzählt, der natürlich kein Held in dem Sinn ist. Eher ein ganz normaler junger Mann aus der westdeutschen Provinz, der am Ende irgendwie doch Erfolg hat im Leben, obwohl es mit kiffenden Freunden in der Hausbesetzerszene losgeht. Und mit dem „Spieler“.
Das mit dem „Spieler“ ist freilich kein Start in ein Fantasy-Spiel, auch wenn es sich stellenweise so liest. Das könnte, wenn es ein Autor wirklich ernst meint, richtig dystopisch und durchgeknallt werden: Irgendwelche unsichtbaren Programmierer begreifen die Welt der Menschen nur als ein riesiges Spielfeld, auf dem sie ihre Spielfiguren in die Menschen pflanzen und so über Fremdsteuerung deren Erfolg oder Scheitern im großen Spiel des Lebens organisieren.
Manchmal kann es einem ja so vorkommen, wenn einen das Leben beutelt, eine Schnapsidee einen so richtig in den Schlamassel bringt, sich Freunde seltsam verhalten und der Zickzack des Lebens einen auf einmal doch mal auf die Siegerstraße bringt. Oder zumindest in gut bezahlte Jobs und zu einem Sack voll Geld, wie es Karsten am Ende geht.
Wenn das Gewissen sich meldet
Aber wie gesagt: Der „Spieler“ ist eher kein Spieler und auch kein Steuermann im Kopf seiner Spielfigur. Das ahnt man schon, wenn die langen Überlegungen dieses „Spielers“ immer wieder in die Handlung eingeblendet werden, in denen sich der „Spieler“ ausführlich Gedanken macht über den Menschen, seine Emotionen, sein Verhalten, seine Motive.
Also ungefähr das tut, was unsere Stimmen im Kopf in der Regel ständig machen. Wir reflektieren alles, was wir tun. Immer. Außer wohl jene Leute, die sich über ihr eigenes Handeln überhaupt keine Gedanken machen. Davon scheint es auch jede Menge zu geben.
Die meisten Menschen haben aber diese Reflexion über das eigene Handeln immer im Kopf. Manche lassen sich dadurch regelrecht lähmen, andere zucken mit den Schultern und machen weiter. Das schlechte Gewissen kommt dann später. Und dann manchmal mit Wucht. Manchmal aber auch erst viele Jahre später – so wie bei Karsten, der nun – irgendwie an der Schwelle zum Rentenalter angekommen, jede Menge Erinnerungen herausholt an Freunde, die teilweise sehr schäbig gestorben sind, und an Frauen, mit denen er einmal zusammen war. Mit den Frauennamen kommt man irgendwann gründlich durcheinander. Der junge Mann hat sichtlich keine Chance verstreichen lassen, wenn ein Rockzipfel in Sicht kam.
Und man wartet natürlich darauf, dass er erzählt, was ihm tatsächlich an diesen jungen Frauen wichtig war. Aber so recht erzählt er das nicht. Vielleicht auch, weil er sein ganzes Leben eben doch irgendwie aus der Perspektive seines „Spielers“ betrachtet, der in seinen Monologen irgendwie indirekt mit den unsichtbaren Programmierern kommuniziert und sich fragt, ob es für das, was dieser Karsten gerade angestellt hat, jetzt Punkte im großen Spiel des Lebens gibt – oder nicht.
Das nervende Korrektiv im Kopf
Dass es diese Programmierer gar nicht gibt, erfährt man dann am Ende der ganzen Geschichte, nachdem Karsten auch ausgiebig über seine Erfolge und Misserfolge als Unternehmensgründer und Manager in der Software-Branche erzählt hat, wo es durchaus hätte spannend werden können, denn in die Welt der Programmierung ist er schon in seiner Zeit als BWL-Student in den 1980er Jahren eingestiegen, hat das Aufkommen der großen IT-Konzerne miterlebt und das Platzen der Dotcom-Blase. Irgendwie ging das alles gut.
Doch spätestens bei einem Klassentreffen, das er zwischendurch mal organisiert, wird auch klar, dass er sich im Nachhinein eben doch Vorwürfe macht, wie schäbig er einst mit einigen Klassenkameraden umgegangen ist. Gedankenlos. Oder einfach deshalb, weil das auf dem Schulhof noch ganz normal war – auch in Zeiten, als es den Begriff Mobbing noch nicht gab.
Fast ist es, als hätte er den „Spieler“ gar nicht so beiläufig erfunden, als wäre dieser Gesprächspartner im Kopf das Korrektiv gewesen, dass ihn irgendwie doch noch zu einem halbwegs ordentlichen Menschen gemacht hat. Aber einem Menschen, der das Leben selbst als Spiel betrachtet, nicht als einen Ort spannender und intensiver Begegnungen mit Menschen. Denn wer macht das schon: Alles, was er tut und erlebt, mit Punkten zu versehen und sich permanent zu fragen, ob das nun punktemäßig eine Verbesserung im Spiellevel war oder doch nicht?
Es kann gut sein, dass das Viele so sehen. Dass man auf diese Weise gut kompatibel ist für eine Welt, in der es vor allem um Geld und Karriere geht. Und um das erquickende Gefühl, genug Bonuspunkte gesammelt zu haben, um ein Level höher zu rücken.
Aber ist das ein Leben? Ist das wirklich das Leben? Geht es tatsächlich nur um Cash? Und um den „Spieler“ im Kopf, der einen dazu bringt, alle Entscheidungen auf ihre finanziellen Folgen hin abzuwägen?
Sucht und Selbstbestimmung
Am Ende ist Karstens Lebensweg vielleicht für ihn erfolgreich. Auch weil er – anders als viele Freunde aus seiner WG-Zeit – nicht in Drogen versumpft ist. Obgleich der „Spieler“ in seinem Kopf sich sehr wohl bewusst ist, dass es im Leben der Menschen viele Süchte gibt und viele davon weder strafbewehrt noch verachtet sind. Spiele in jeder Form gehören dazu, die Jagd nach Geld genauso. Und so steht natürlich die eigentliche Frage: Ist der Mensch dann wirklich ein selbstbestimmtes Lebewesen? Handelt er nach eigenem Gewissen und eigener freier Entscheidung oder sendet ein unsichtbarer „Spieler“ ihm Botschaften in den Kopf, nach denen er sich dann entscheidet? Botschaften, die gar nicht direkt so funktionieren müssen, denn die ganze Zeit grübelt das Wesen ja auch darüber nach, ob denn in den anderen Menschen nicht auch solche Wesen aktiv sind, die ihrerseits ihre Spielfiguren animieren.
Nur: Spielt man da nun miteinander oder gegeneinander?
Oder ergibt sich gar ein völlig unübersichtliches Spielfeld, weil die „Spieler“ nicht wissen, was die anderen „Spieler“ gerade vorhaben. Und sie alle wissen wiederum nicht, was die unsichtbaren „Programmierer“ eigentlich vorhaben und ob sie sich als deren Geschöpfe richtig verhalten.
Das kann schon sehr kompliziert werden und zeigt im Grunde auch, wenn man an solche Fremdprogrammierung (oder göttliche Vorherbestimmung) glaubt, wohin einen das gedanklich führt: in ein regelrechtes Chaos. Und in Fragen, die sich am Ende nicht mehr beantworten lassen, wenn Menschen anfangen, sich als fremdgesteuert zu verstehen. Karsten kündigt seinem „Spieler“ am Ende und dankt ihm für die aufmerksame Begleitung.
Aber das ist natürlich auch nur ein künstlerischer Schachzug. Man wird sein Gewissen nicht los. Und: Das Gewissen ist keine Fremdsteuerung. Es erinnert uns nur permanent daran, dass wir soziale Wesen sind und dass alle unsere Handlungen auch Folgen für unsere Mitmenschen haben. Und dass wir uns eben nicht einfach rücksichtslos und ohne Verständnis für andere Menschen benehmen können, ohne dass es zumindest eine Quittung in Form von Gewissensbissen gibt.
Oft leider zu spät, sodass auch Karsten sich bei den Menschen, die er verletzt und gekränkt hat, nicht mehr entschuldigen kann. Das kann man dann eben nicht mehr delegieren. Es bleibt als Erinnerung, die einen dann eben doch daran erinnert, dass das scheinbar so interessante Leben eben doch etliche dunkle Stellen hat, an denen sich der „Held“ ganz und gar nicht heldenhaft benommen hat. Und am Ende ist es wohl eher Glück für ihn, dass er trotzdem überlebt hat, sich den Altersgefährten als erfolgreicher Geschäftsmann zeigen kann.
Aber die skeptischen Überlegungen seines „Spielers“ haben noch einen Effekt: Sie erzeugen eine enorme emotionale Distanz zu Karsten, die es ohne all die ausführlichen Zwischenpassagen nicht gäbe. Sie setzen sein ganzes Leben unter kritische Beobachtung.
Und so wenig wie dieser nachdenkliche „Spieler“ kann auch der Leser am Ende entscheiden, ob er Karstens Leben als besonders gelungen bezeichnen soll. Oder doch eher als einen nicht wirklich wärmenden Versuch, die Bilanz eines Lebens zu rationalisieren.
So gesehen ist auch der Abschied nicht so recht ernst zu nehmen, auch wenn Karsten meint, sein „Spieler“ habe sich im Nachdenken über die Motivation der Menschen zu sehr verrannt. Denn diese verzwickte Lage bleibt bestehen, egal, ob man sein Gewissen in den Ruhestand schickt oder sich den immer weiter bohrenden Fragen stellt, die sich alle um die Frage drehen, wofür man als Mensch eigentlich lebt. Und was dem eigenen Leben wirklich einen Sinn gibt.
Bis zuletzt geht es um die Frage der Selbstbestimmung und all die Konflikte, die wir im Kopf austragen, wenn Entscheidungen verzwickt und uneindeutig sind und wir nicht wissen, ob wir damit Schaden anrichten. Darüber denkt man in der Jugend noch nicht wirklich oft nach. Später aber schon, wenn man merkt: Da sind einige Dinge passiert, für die man sich noch im Nachhinein ohrfeigen möchte. Unser Gewissen erinnert uns genau daran.
Pech für Karsten: Man schickt es nicht einfach in die Wüste. Wen es erst einmal plagt, den lässt es auch nicht mehr los.
Christian Heinisch „Das Wesen des Seins“ Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 19,90 Euro.
Am Hohai: Peking, die Kunst und Mos lange Suche nach sich selbst
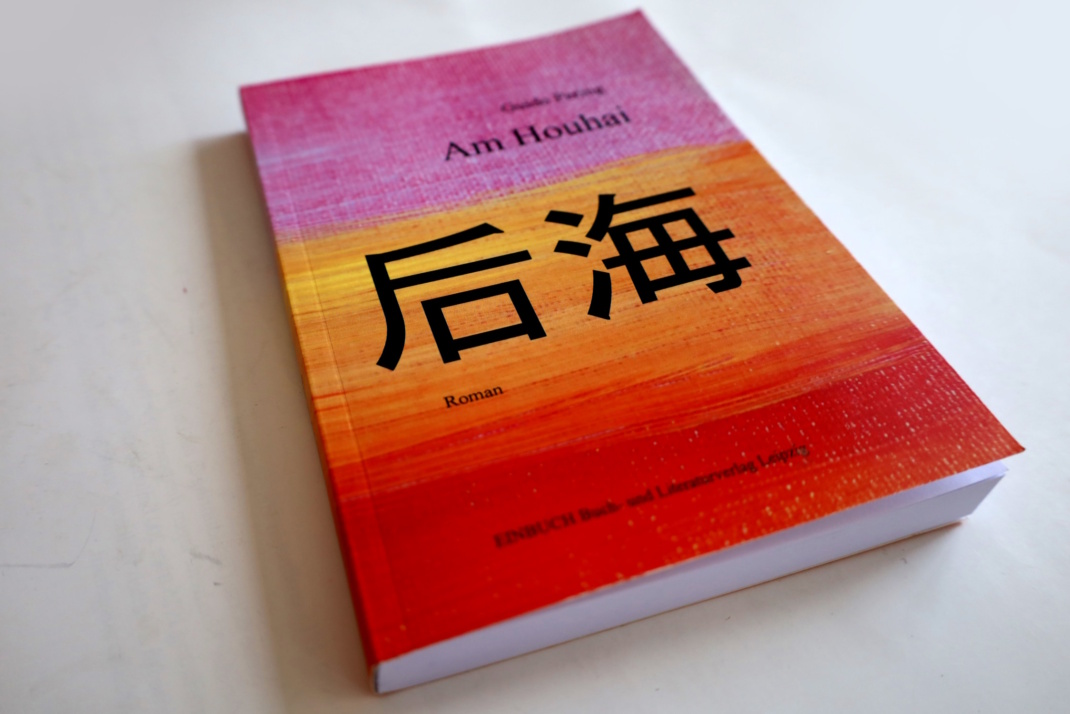
Der Hohai ist ein See in Peking, sogar im alten Peking, wo noch nicht die Hochhausquartiere dominieren und sogar Platz ist für Menschen, die ihren Traum von einem der Kunst gewidmeten Leben verwirklichen möchten. So ganz zufällig landet der Kölner Künstler Heinrich Brecher hier nicht, der sich mit seiner Ankunft in Peking fortan Mo nennt. Guido Perings Roman ist ein bisschen mehr als nur ein Künstlerroman.
Auch wenn es nicht nur Mo und seiner Freundin Ye Yang um die Suche nach dem richtigen Weg geht, ihre künstlerischen Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen. Romane sind auch wie Kunstwerke, ziemlich große sogar. Und sie sind genauso widerspenstig wie Leinwände. Und am Ende erzählen sie von Dingen, die der Autor eigentlich gar nicht erzählen wollte. So wie es auch Malern und Bildhauern ergeht. Man kann zwar die Techniken lernen und die ganze Kunstgeschichte studieren. Man kann Galerien besuchen und alles im Internet lesen, was zur modernen Kunstszene zu finden ist.
Aber was dann tatsächlich unter den eigenen Händen entsteht, das weiß niemand, der sich wirklich auf künstlerisches Arbeiten einlässt. Oder er scheitert, wie das für so ungefähr 90 Prozent dessen zutrifft, was einem als Kunst dargeboten oder als Roman verkauft wird. Sogar als Bestseller.
Dies hier ist natürlich (noch) kein Bestseller. Dazu ist der EINBUCH-Verlag zu klein und das deutsche Feuilleton zu abgehoben und zu sehr konzentriert auf die üblichen Namen und Attitüden. Pering hat nicht nur Peking schon mehrfach besucht. Ihn faszinieren besonders „die Kraft und Vielfältigkeit der Kunst und ihrer Schaffensprozesse“, sagt er von sich selber aus.
Die Krise des Heinrich Brecher
Aber tatsächlich ist sein Roman die Geschichte einer Lebenskrise. Vielleicht sogar die einer Weltenkrise. Denn schon bei seiner ersten Ankunft ist Heinrich Brecher eigentlich auf der Flucht. Dafür steht nicht nur sein inniger Wunsch, sich mitten im alten Peking einzuquartieren und hier einen neuen Zugang zu seinem eigenen Kunstschaffen zu finden.
Der Name, den er sich zulegt, steht genauso für diesen Neuanfang wie für den tief sitzenden (und nicht wirklich eingestandenen) Wunsch, mit dem alten Leben gründlich Schluss zu machen. Was das wirklich bedeutet, weiß er noch nicht, findet aber erstaunlich schnell Kontakt und Menschen, die diesen von sich eingenommenen Europäer doch irgendwie zu schätzen lernen – so sehr, dass er, als er nach sieben Monaten überstürzt wieder abreist, ein regelrechtes Loch hinterlässt.
Nicht nur bei Ye Yang, die er in der Galerie des alten Zhang kennengelernt hat und die selbst verblüfft ist, dass sie sich auf diesen besessenen Künstler einlässt. Ein kleiner Freundeskreis ist um ihn gewachsen, etwas, was er so bisher nicht kannte.
In Köln hat er im Grunde nur seine Eigentumswohnung und seine Konten zurückgelassen. Er hat von seinen Eltern ein kleines Vermögen geerbt, ist also als Künstler so frei, tatsächlich nur das zu machen, was ihm wesentlich erscheint. Was nicht heißt, dass es auf der Hand läge. Doch dieses Peking, das er sich auf weiten Spaziergängen erschließt, nimmt ihn in Bann, lässt ihn tatsächlich Stück für Stück wieder die Lust am Malen und Gestalten von Collagen finden.
Rückkehr und Absturz
Und trotzdem bricht er auf, als sein Notar in Deutschland meint, es gäbe mal wieder ein paar Dinge zu klären. Aus der kurzen Rückkehr wird ein langer Aufenthalt in einer Stadt, in der sich – aus seiner Sicht – nichts geändert hat. Er mietet sich wieder ein Atelier und versucht zu malen. Aber die Rückkehr endet für ihn in einem regelrechten Absturz. Das, wovor er geflohen ist, holt ihn wieder ein.
Und das kann man durchaus doppelt lesen, den Pering gestaltet es sehr atmosphärisch. Dieser Heimgekehrte leidet nicht nur darunter, dass ihm hier auf einmal nichts gelingen will. Er leidet auch unter der eisigen, letztlich herzlosen Stimmung in diesem Land und in dieser Stadt. Als hätte dieses Land, das die Chinesen aus der Ferne so bewundern, seine Herzlichkeit und Wärme schon vor langer Zeit verloren, wäre in Gleichgültigkeit und Ambitionslosigkeit versunken, behäbig und dumm geworden in seinem eingebildeten Reichtum.
Der eigentlich keiner ist, wenn daraus keine menschliche Nähe erwächst. Dieser Nähe findet er in Carlsson, die im Haus gegenüber lebt und die ihn vorm Erfrieren (in des Wortes doppelter Bedeutung) bewahrt. Auch sie eine, die sich nicht arriviert hat in diesem Land, in dem alles erstarrt und leer geworden zu sein scheint. Sie lebt lieber von der Hand in den Mund und versammelt ebenso lebendige Seelen um sich.
Und am Ende ist sie es, die Heinrich Brecher aus seiner tiefen Verlassenheit holt. Zwei Seelen begegnen sich, verstehen sich und nehmen sich an der Hand. Und gleichzeitig fühlt man sich als Leser in diesem tristen, leeren Köln genauso unbehaglich. Als würde einem die schäbige und sinnlos gewordene Seite dieses Deutschlands gezeigt, das sich in seiner Oberflächlichkeit eingerichtet hat und Menschen wie Brecher nur noch deprimiert. Sodass natürlich die Sinnfrage auftaucht – die Stadt betreffend, das Leben, aber auch die Kunst.
Die Wurzeln des Lebendigseins
Und eine tiefe Angst kommt hinzu, die Brecher bislang als Teil seiner Auftritte gepflegt hat: wirkliche Nähe zuzulassen und Menschen, Frauen insbesondere, tatsächlich nahe kommen zu lassen. Auch das spielte eine Rolle bei seinem schnellen Aufbruch in Peking. Und es wirft ihn im nassen und kalten Köln in einen unlösbaren Konflikt. Vielleicht sind es am Ende ja tatsächlich die Bemühungen seiner Freunde, die ihn dazu bewegen, doch wieder ins Flugzeug zu steigen und sich auf das ferne Peking einzulassen. Eine Stadt, die ihn viel stärker in ihren Bann geschlagen hat als das verschlossene Köln. Und nur am Rand spielt die Politik eine Rolle.
Auch das ein Romanmotiv, das davon erzählt, dass es im Leben nicht um die Mächtigen geht, auch in der Kunst nicht, sondern immer um das konkrete Da-Sein und die konkreten Menschen, denen man begegnet. Und manchmal muss man wohl tausende Kilometer weit fliegen, um diese Menschen zu finden und das Gefühl zu finden, das Brecher alias Mo so intensiv sucht: verstanden zu werden in dem, was man tut.
Und damit endlich so etwas wie einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen und wieder Mut zu fassen, die Dinge zu tun, die einem wirklich wichtig sind. Und die dann andere – vielleicht – wieder berühren. So wie gute Kunst die Betrachter berührt, auch wenn sie oft nicht wissen, wie der Künstler es gemacht hat. So wie es selbst der fast legendäre Wolkensturm nicht weiß, der durch die Ereignisse um Zhangs kleine Galerie aus seiner jahrelangen Einsamkeit herausgerissen wird.
Er hat zwar einen Weg für sich gefunden, in der selbstgewählten Anonymität die Kunst entstehen zu lassen, die er für gültig hält. Aber diese mönchische Einsamkeit ist eben doch nicht alles, was ein erfülltes Künstlerleben ausmacht.
Zeit und Gelassenheit
Im Grunde ist Wolkensturm wie der lebendige Widerspruch zu Mo, der auch nach seiner Rückkehr nach Peking mit dem hadert, was er auf die Leinwand bringt. Aber es ist auch, als würden all die Gewichte, die Mo in Köln zu Boden gezogen haben, langsam von ihm abfallen. Als würde er wieder Kontur bekommen als lebendiger, wenn auch ein bisschen spröder Mensch. Kontur, die einem letztlich nur die Menschen geben können, die einen tatsächlich ins Herz geschlossen haben und so haben wollen, wie man ist.
So gesehen ist das ganz gewiss auch ein sehr persönlicher und berührender Roman. Einer, der davon erzählt, wie schnell wir uns verloren gehen, wenn wir die Wurzeln verlieren, die uns mit anderen Menschen und Orten verbinden. Und das schimmert auch in allen Kommentaren der chinesischen Protagonistinnen durch, wenn sie das ferne Europa kommentieren: Sie haben sehr wohl gemerkt, dass die entgrenzte Selbstverwirklichung im Westen auch eine dunkle, sehr kalte Seite hat.
Auch deshalb ist Mo ja in Peking gelandet, in einer kleinen Welt, die selbst bedroht ist. Das wissen auch die Menschen, die den kleinen Kosmos um diesen eigensinnigen Deutschen bilden. Es gibt keine Garantie, dass die Orte, an denen Menschen ihre Heimatlosigkeit abstreifen können, erhalten bleiben. Schon gar nicht in einer Welt, in der sich alles ums Geld und ums „Machen“ dreht.
Es steckt auch ein schönes Stück „Lassen“ in der Geschichte. Am Ende macht Mo erst einmal eine schöpferische Pause. Denn auch das hat er gelernt: Dass „Zeit“ nicht das ist, was er da aus Europa mitgebracht hat, dieses drängende Gefühl, immerzu etwas machen zu müssen. Eher ist es das Geschenk, einfach einmal loslassen zu dürfen und schauen zu dürfen. Was davon dann zum Kunstwerk reift, das wird die Zeit dann zeigen. Aber erst einmal muss man wohl lernen, dass man diese Zeit hat. Und dass sie ein kostbares Geschenk ist.
Guido Pering „Am Hohai“ EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig, Leipzig 2024, 17,40 Euro.
Der Stubenvirtuose: Die ganz und gar nicht unerhörte Geschichte eines Regensburger Einsiedlers

Es ist schon nicht so einfach mit den literarischen Gattungsbezeichnungen. Max Halder hat für sein Prosastück den Begriff der Novelle gewählt. Und auch gleich noch den Untertitel „Wie man Denken überleben kann“. Man merkt schon: Es wird verzwickt. Denn wirklich ernst gemeint ist nur der Stubenvirtuose aus dem Titel: Aaron heißt er, hat vor ein paar Jahre sein Pharmakologiestudium beendet, dann aber beschlossen, sich nicht in einem Brotjob zu verausgaben.
Seine Stube hat er im schönen Regensburg, mittendrin in der alten Bischofsstadt. Manchmal nennt er sie auch Gelehrtenstube. Aber ein so recht produktives Gelehrtenleben lebt er nicht. Will er auch nicht leben. Denn eigentlich hat er beschlossen, „nicht in den Sog des technokratischen, prahlerischen, überregulierten, inspirationslosen, unverantwortlichen, unästhetischen, globalideologischen Zeitgeists zu geraten.“
Was man durchaus nachvollziehen kann. Da wäre er nicht der Einzige, der am rücksichtslosen Zerstören der Welt durch ein blindes Technokratiedenken nicht teilhaben will. Wir leben in einer Zeit der Aussteiger.
Und der Verweigerer.
Nur: Was tun? „Denn er wusste, dass seine schlafenden und betäubten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen dort drinsteckten, eigentlich herauswollten, aber doch nicht herausfanden. Sie wollten heraus, denn sie spürten, dass etwas nicht in Ordnung war. Was genau das war, war unerheblich. Die Richtung stimmte nicht.“
Wen Unerhörtes nicht geschieht
Aarons Problem aber ist: Eigentlich will er mit seinen Zeitgenossen auch nichts zu tun haben. Wirkliche Begegnungen vermeidet er, setzt sich beim Laufen durch die Gassen der Altstadt lieber Kopfhörer auf und hört Musik. Deswegen passiert in dieser Geschichte auch nichts. Auch nichts Unerhörtes, um auf Goethes Novellen-Definition zurückzukommen.
Der Held der Geschichte ist am Ende noch genauso derselbe wie am Anfang. Er hat sich zwar diverse Drogen eingeworfen und einen Tag sogar regelrecht planmäßig in einem gewaltigen Drogenrausch verbracht. Denn er weiß ja, wie man sich das Zeug herstellt. Dazu kann er das Labor eines ehemaligen Studienkollegen nutzen.
Aber es ist wie so oft, seit man die schwärmerischen Versuche etwa von Jack Kerouac gelesen hat, das Besondere des im Drogenrausch Erlebten zu beschreiben: Es bleibt beim Schwärmen. Die große Bewusstseinerweiterung bleibt im Kopf der Protagonisten. Nichts davon wird hernach zur genialen Erkenntnis der Welt. Auch nicht bei Aaron, der sich ja sowieso längst eingeigelt hat in seiner Gedankenwelt. Die er für schwer und besonders intensiv hält.
Er hat sich sein Leben mit 800 Euro eingerichtet, braucht nicht mehr, will nicht mehr. Doch so wirklich glücklich scheint er in seinem Einsiedlerleben auch nicht zu sein. Auch wenn er sich Regeln gesetzt hat, die den leeren Tagen irgendwie Struktur geben – Yoga, Malen und Schreiben gehören dazu. Aber das Einzige, was er schreibt, ist am Ende eine Kritik zu einem Film im Klubkino, in dem ein Regisseur fünf Stunden lang versucht hat, die Beliebigkeit des Lebens zu zeigen.
Da könnte es philosophisch werden. Aber Aaron ist kein philosophischer Kopf. Auch wenn er meint, einer zu sein. Auch Philosophie lebt von der Begegnung, von Gesprächspartnern. Aber ist denn nicht alles Gespräch schon kaputt in unserer Gesellschaft? Hat sich Aaron nicht auch deshalb aus der langweiligen Jobwelt verabschiedet?
„Das Bedienen von und Warten auf Maschinen, das Abarbeiten von Vorschriften und Betriebsanweisungen, das stetige Ausführen der immer selben Handgriffe“, erinnert er sich an das öde Arbeitsleben, dem er aber schon seit vier Jahren entgeht. „Das Resultat zeigt sich in einer Art domestizierten Faul- und Fadheit, die sich derer ermächtigt, die sich nicht entschlossen genug dagegen wehren.“
Eine Anti-Novelle
Da könnte der Anfang einer Geschichte stecken. Andere gehen deshalb auf die Barrikaden, in die Politik oder in verrückte Bürgerinitiativen, suchen sich neue Freunde, die einen wirklich fordern, die auf Augenhöhe sind und denen das inhaltsleere Blabla der normierten Welt ebenso auf den Keks geht. Die gibt es. Natürlich gibt es die. Sie machen ihr Leben zur Novelle und riskieren Unerhörtes. Goethe hat’s verstanden. Wird er nicht mehr gelesen in der Schule?
Was Max Halder letztlich mit diesen einsamen Tagen seine Stuben-Helden gelingt, ist eher reine Anti-Novelle: Es passiert gar nichts Unerhörtes. Außer dass man einen jungen Mann kennenlernt, der eigentlich nicht weiß, was er im Leben will, außer seine Tage allein zu verbringen, mit Gedanken, die ganz und gar nicht so gefährlich sind, dass sie lebensgefährlich wären.
So wenig, wie die vielen Weltenrettungsgespräche auf trunkenen Studi-Partys lebensgefährlich sind. All dieses Gerede über „das System“, das auch in Max Halders Geschichte so unkonkret und ungreifbar bleibt wie in so vielen anderen „Das System ist schuld“-Erzählungen.
Aaron jedenfalls kommt in all den durchgrübelten Tagen zu keiner Entscheidung: „Funktioniert das System, überhaupt, ist das System zu retten und überhaupt: Muss das System gerettet werden? Ist es nicht sinnvoller, das System zu dekonstruieren, das System von Grund auf neu aufzubauen?“
Die Sache mit dem Zeitgeist
Es scheint ein Generationenproblem zu sei : „Glücklich sein? Mächtig sein? Reich sein? Alles zu hoch gegriffen? Zufrieden sein? Eine kleine Oase aufbauen? Helfen? Wenn all diese Fragen nicht im Ansatz geklärt sind: Wie sollte Aaron und mit ihm mindestens eine ganze Generation eine Entscheidung treffen können?“
Aaron jedenfalls trifft keine. Aber die Fragen sind ja nicht dumm. Denn was wollen und sollen wir auf der Welt? Dass die Angebote, die eine in Wohlstand versackte Gesellschaft bietet, die nur noch das große heilige Wachstum im Kopf hat, keine wirklich guten Angebote sind, wissen viele, spüren viele. Manche verweigern sich dann auf ähnliche Art wie Aaron. Ratlos und ohne die Kraft, wirklich Entscheidungen zu treffen.
Denn wenn man etwas ändern will, müsste man schon wissen, wie es hinterher aussehen soll. So weit aber kommt der in seiner Stube Sitzende nicht. Vielleicht auch, weil man dazu den Mut braucht, hinauszugehen und Gleichgesinnte zu suchen. Sich einzulassen auf Menschen.
Das heißt auch: Manchmal aus der Spur zu geraten, anzuecken, den Halt zu verlieren. Etwas, was Aaron scheut. Lieber sucht er in langen Yoga-Runden seine Erdung. Nur ja nicht abheben.
Oder in der „Trichter des Zeitgeistes“ geraten. Denn wenn man da hineingerät, „hält einen Gelderwerb, hält einen die Fata Morgana der Versicherungen und Sicherheiten, der Annehmlichkeiten und Neiderzeuger darin gefangen.“ Ein Zustand übrigens, den Aaron ebenso als Einsamkeit und Verlorenheit interpretiert. Denn wer immerzu nach dem Gelde streben muss, hat keinen Ort, um sich des Wesentlichen im Leben zu besinnen. Ein Ort, von dem Aaron anzunehmen scheint, dass er ihn in seinem Stubendasein gefunden hat.
Fausts Einsamkeit
Was bleibt am Ende? Ein Bursche, der seine Abenteuer im Kopf erlebt. Und sich eigentlich nur für eins entschieden hat: Sich für nichts zu entscheiden. Dazu berühmte Autoren zu zitieren wie Heisenberg und Jung. Aber das ändert nichts. Er verlässt die Beobachterposition nicht – darin sogar Goethes Faust sehr ähnlich, der in seiner Kammer auch schon glaubte, alles studiert zu haben und alles zu wissen: ein kauziger alter Eigenbrötler, der die Begegnung mit den Menschen da draußen schon aus Prinzip meidet. Genauso wie dieser Aaron, wenn er sich mal rausbegibt ans Donauufer: „Wie sinnbildlich seine stundenlangen Spaziergänge durch die alte Bischofsstadt, wie offenbarend die Dutzenden Läufer am Donauufer, wie erschlagend das tagtägliche Treiben in den Gassen und Straßen dieser und jeder andere Stadt auf diesem Planeten.“
Da will er gar nicht dazugehören, gar in den Wirkkreis anderer Leute geraten, in dem man sich verheddern könnte.
Das war auch Fausts Problem. Aber nicht Goethes, der sehr wohl wusste, dass das Leben erst da beginnt und wesentlich wird, wo man sich den scheinbar so närrischen Anderen aussetzt, Beziehungen eingeht und Wirkungen erzeugt und erlebt. Man möchte dem arme Aaron ein Pferd schenken.
Das Prinzip Verantwortung
Aber der scheint am Ende ganz mit sich zufrieden, fühlt sich „unheimlich aufgeräumt, sortiert, geordnet“ als Ergebnis seines wohl kalkulierten Drogenrausches am Tag zuvor. Sein Leben dreht sich nur noch um ihn selbst, auch wenn er sich ab und zu vornimmt, sich „um mein Mädchen“ zu kümmern, was er aber trotzdem nicht tut. Vielleicht kümmert sich das Mädchen sogar längst schon um sich selbst. Man kann auch vor lauter Grübelei über „das eigentlich Nicht-Zu-Verstehende“ vergessen, dass das Leben das eigentlich Unaufgeräumte und Unfertige ist, aus dem man etwas machen könnte.
Aber das hätte dann mit Verantwortung zu tun, jener Verantwortung, die Halder mit Hans Jonas’ „Prinzip Verantwortung“ zitiert. Doch sein Aaron wählt die Nicht-Verantwortung, das Nichtsein, das so schön frei ist „von allen Unvollkommenheiten, die jeder positiven Wählbarkeit anhaften“ (Hans Jonas). Denn darum geht es am Ende. Auch in Aarons Gedanken, wenn er sich selbst immer wieder erklärt, warum er mit dem Treiben der Menschen da draußen nichts (mehr) zu tun haben will.
Er hat die Nichtverantwortung gewählt, weil jedes wirkliche Begegnen mit Menschen voller Unvollkommenheiten ist. Zwangsläufig. Aber es sind genau diese Unvollkommenheiten, die erst Geschichten zu Geschichten werden lassen. Und Menschen Novellen erleben lassen. Manchmal sogar von unerhörter Art.
Und so hat der Mensch tatsächlich die Wahl. Und ganz bestimmt gibt es nicht wenige, die sich so absentieren wie Einsiedlerkrebse, wie es dieser Aaron tut. Zunehmend voller Scheu vor den Anderen da draußen.
Ein Pudel könnte helfen, denkt man sich da. Pudel in Studierstuben haben schon so manches einsame Leben in eine neue Geschichte verwandelt.
Max Halder „Der Stubenvirtuose“ EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 15,40 Euro.
Brandungsmädchen: Ein Kriminalroman mit Schimmelreiter-Atmosphäre

Pellworm soll eigentlich eine schöne Insel sein, wenn auch vom Meer gefährdet als Überrest der einstigen Insel Strand. Vielleicht ein bisschen einsam, erreichbar mit einer Fähre, von hohen Deichen umgeben, denn die Insel liegt einen Meter unter Normalnull. Und wer sie heute von Ausflügen kennt, wird sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen in Matthias Stolzenbergs Kriminalroman, der eher ein Thriller ist und da und dort ein wenig an Theodor Storms „Schimmelreiter“ erinnert.
Das ist kein Zufall, denn Theodor Storms Novelle handelt ja in der Hattstedtermarsch in Nordfriesland, etwas nördlich von Pellworm gelegen. Hier wie dort wehrt man sich seit Jahrhunderten gegen die Fluten, verteidigt das Land gegen die hungrige Nordsee. Und wenn die Urlaubersaison zu Ende geht, kann es tatsächlich recht einsam werden.
Vielleicht nicht ganz so einsam, wie es Stolzenberg seinen dänischen Kommissars Owe Thomson erleben lässt, der im Auftrag von Interpol versucht, einen 16 Jahre zurückliegenden Entführungsfall auf der holländischen Insel Texel aufzuklären. Damals verschwand die zweijährige Marthe Saalkämper.
Der dunkle Schatten der Geschichte
Dass Stolzenbergs Insellandschaft so einsam und dunkel wirkt, hat auch mit der Zeit zu tun, in die er die Handlung der Geschichte verlegt hat – den Herbst 1993. Da muss sich der ostdeutsche Polizist Karl Sudberg, der zusammen mit einer Hamburger Polizeianwärterin zu Thomsons Unterstützung herbeigerufen wurde, noch sagen lassen, er käme aus der DDR.
Auch wenn der Osten eher keine Rolle spielt in seiner Handlung, sondern die alte, gemeinsame deutsche Geschichte. Weshalb auch das Jahr 1993 so wichtig ist. Denn noch leben einige der schlimmsten Täter aus der Nazi-Zeit. Einer spielt in diesem Buch eine sehr zentrale Rolle und sorgt auch dafür, dass Thomson, als ihn die Spur nach Pellworm führt, gleich das Gefühl hat, dass es hier richtig brenzlig werden wird.
Wobei das auch an diesem wunderlichen dänischen Kommissar selbst liegt, denn er agiert eher als Eigenbrötler, nimmt auf die eigene Gesundheit (und seine Kleidung) nicht viel Rücksicht und landet mehrmals in Situationen, in denen sein Leben an einem Faden hängt. Und das in einer Zeit, in der es noch keine Handys gab, sondern nur Telefonzellen und rustikale Bakelittelefone.
Wer da dann auf einmal allein in einer Mühle, auf dem Friedhof oder dem mit Steinbuhnen besetzten Strand von Pellworm auftaucht, kann auf schnelle Hilfe nicht hoffen.
Und manche riskieren ihr Leben im Watt sogar mit Absicht. Oder weil sie betrunken sind.
Rätsel über Rätsel
Und dann sind da noch die drei Mädchen, die dem Buch den Titel gegeben haben, bekannt geworden durch ihre Besessenheit von den Wellen der Nordsee, auf die sie fast bei jedem Wetter mit ihren Surfbrettern hinausschwimmen. Oder es getan haben, vor Beginn dieser Geschichte. Denn einem von ihnen war es längst zu unheimlich geworden auf der Insel. Das erfährt Thomson sogar lange, bevor ihn der Fall tatsächlich nach Pellworm führt.
Er ist zwar einer, der sich alles Mögliche leicht merkt und der schon früh die richtigen Puzzlesteine zur Lösung des Rätsels zusammenbekommt. Aber statt direkt zu fragen und Verdächtige gleich mal mit polizeilichen Mitteln festzusetzen, versucht er irgendwie undercover den Fall zu lösen. Und noch weitere Rätsel zu knacken, wenn eigentlich alle Spuren schon offen liegen.
Vielleicht, weil er tatsächlich Angst hat, einem der Brandungsmädchen könnte etwas zustoßen. Vielleicht auch, weil er einen Schuldigen schonen will, weil er irgendwie Verständnis hat für dessen Tun. Oder auch, weil er einer Zeugin auf Texel, die den Schuldigen deckt, irgendwie für sich versprochen hat, sie nicht zu verraten.
Und gleichzeitig weiß er, dass auch noch ein paar andere Leute interessiert daran sind, dass so Manches über Pellworm nicht ruchbar wird. Leute, die auch vor Mord nicht zurückschrecken. Und die auch noch lange nach dem Krieg ihren abstrusen Ideen nachhängen und wie eine Art Geheimbund agieren.
Die Abgeschiedenheit der Insel hilft dabei. Aber nur bedingt. Denn gerade erst erschüttert ein Skandal um einen dänischen Minister die Medien, dessen Lebenslauf sich als eng verquickt mit der Nazi-Zeit erweist. Spät beginnen die Mühlen der Aufklärung zu mahlen. Aber die Zeit, dass alles unter den Teppich gekehrt wird, ist vorbei.
Die Moral der Täter
Und trotzdem bleiben diese Leute gefährlich. Bereit zu töten und ihre Spuren zu verwischen. Gnadenlos auch ihren eigenen Kindern gegenüber. Das ist die eigentliche Geschichte in diesem von Blitz und Sturm durchleuchteten Plot, wahrscheinlich sogar das, was den 1964 in Hamburg geborenen Autor bewegte, überhaupt so eine Entführungsgeschichte zu schreiben.
Denn die Eiseskälte, mit denen die Nazis quälen und töteten, ist ja nicht einfach verschwunden, nur weil ihr Reich in Trümmer fiel. Sie lebte in einer grimmigen, eisigen Moral weiter. Und darunter litten auch zuerst die Kinder der Täter, in diesem Fall Richard Martens, dem sein Vater dereinst aus Wut ein Ohr abschlug, und der auch Jahrzehnte später immer noch alles tut, um in den Augen des gewalttätigen Vaters Anerkennung zu finden.
Die er aber nie bekommt. Denn Täter wie sein Vater, Obersturmbannführer Hans Erich Martens, lassen sich nicht erweichen, kennen erst recht kein Mitgefühl. Wenn sie einmal beschlossen haben, das Versagen der Schwächeren als Schwäche zu sehen, dann bleiben sie dabei. Und lassen es die Menschen auch spüren.
Wenn man das so formuliert, merkt man: Das ist mit den alten Nazis nicht gestorben. Das hat sich in vielen Familien als Trauma weiter vererbt. Denn oft werden die Söhne von Tätern ebenfalls zu Tätern. Auch weil sie um die Liebe ihrer Väter werben, die sie trotzdem nie bekommen. Und die jederzeit wieder genommen wird, wenn sie das zeigen, was diese „Herrenmenschen“ als Schwäche deuten.
Weshalb es rechtsradikale Parteien in Deutschland immer wieder so leicht haben, ihr Wahlvolk einzusammeln. Mit derselben Verachtung für Schwäche, Rücksicht und Toleranz. Sie reden zwar viel von Familie und Heimat. Aber sie sind jederzeit bereit, das alles auch mit Stiefeln zu zertreten und verbrannte Erde zu hinterlassen.
So wie in Albanien, wo Hans Erich Martens seine Spuren hinterlassen hat und einfach seine Tochter zurückließ, als er seinerzeit floh. Nur den Sohn bei sich, den er zum Gehorsam geprügelt hatte.
Klavierspielende Täter
Was aus seiner Tochter und deren Tochter Dita geworden ist, hat den Mann sichtlich nicht interessiert. Ein Mann, den Stolzenberg auch in seiner scheinbaren Widersprüchlichkeit zeigt – als brutalen Tätowierer im KZ einerseits und als Klavierspieler, der dann mit Richard Wagner scheinbar in den großen Kulturhimmel der Deutschen abhebt. Als ginge das nicht zusammen zu denken: Brutalität und Geniekult. Ging es aber doch.
Wahrscheinlich war das schon immer die falsche Ebene, den deutschen Faschismus begreifen zu wollen. Dem kommt man viel näher, wenn man sieht, wie die Erwachsenen mit ihren Kindern umgehen und was sie ihnen tatsächlich fürs Leben vermitteln. Und wie sie Liebe mit Gehorsam verwechseln.
Alice Miller nannte es einst „schwarze Pädagogik“, aus eigener Erfahrung wohl wissend, wie schwer es aus der Perspektive der Betroffenen überhaupt ist, diese Muster der Abhängigkeit und der missbrauchten Liebe zu erkennen.
Und dann auch noch die Machtstrukturen aufzulösen, die dahinter stecken. Und die eben auch die Politik und das Klima einer Gesellschaft färben. Auch noch weit über die Kindergeneration hinaus. Obgleich gerade die drei Brandungsmädchen sich scheinbar von diesem Druck nie haben beeindrucken lassen. Auch nicht von der damit ausgelösten Angst, die Owe Thomson schon beim Betreten der Insel verspürt.
Wobei er sie nicht richtig festmachen kann, außer in dem seltsamen Auftauchen eines älteren holländischen Polizeikollegen, dessen Spiel er nicht wirklich durchschaut. Hilft der ihm nun, den Fall aufzuklären? Oder will er verhindern, dass er den Täter findet?
Stolzenberg jedenfalls genießt es, jedes Kapitel atmosphärisch ordentlich aufzuladen. Als wolle er wirklich eine stürmische Hommage an Theodor Storm schreiben, der dieser geschundenen Küste ja ein literarisches Denkmal gesetzt hat, an dem man nicht vorbeikommt. Und vielleicht ist der Herbst tatsächlich die beste Gelegenheit, sich auf Pellworm eine ordentliche Gänsehaut zu holen.
Zum Surfen ist er wohl eher nicht so empfehlenswert, es sei denn, man wäre so tollkühn wie Espe, Greta und Sophie.
Mattias Stolzenberg „Brandungsmädchen“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2022, 21,90 Euro.
Comando Cordobazo: Fußball, Politik und eine Entführung mit unerwartetem Ausgang
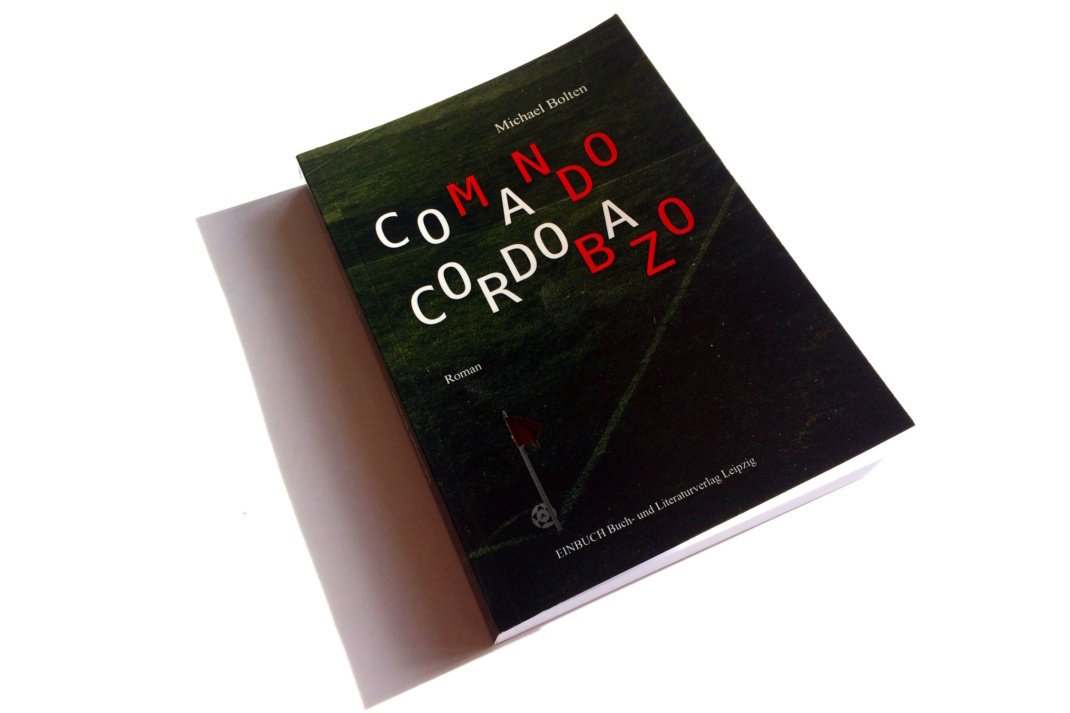
Es war vor und nach den Fußballweltmeisterschaften in Katar 2022 eine höchst peinliche Vorstellung, die auch der deutsche Fußballverband gab. Denn wenn es um große Sportereignisse geht, die in Autokratien und Diktaturen stattfinden, werden deutsche Sportfunktionäre immer sehr windelweich. Dann soll Sport bzw. Fußball mal eben nichts mit Politik zu tun haben. Das war auch 1978 so, als die Fußball-WM in Argentinien stattfand. Ein höchst aktueller Vergleich, fand Michael Bolten.
Er hat Politologie studiert, schreibt für mehrere Medien, hat mit Martin Krauß in den 1990er Jahren die Zeitschrift „Sportkritik. Die Zeitschrift gegen das Unentschieden“ herausgegeben und inzwischen fünf Bücher veröffentlicht, die alle „,mehr oder weniger um seinen Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf kreisen“.
Dies ist sein erster Roman. Und auch der hat mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Sein Held: der Jungstar Tommy Küpper, der 1978 so gut spielt, dass er es in den Nominierungskader für die Fußball-WM in Argentinien schafft. Eigentlich ein junger, sympathischer Kerl, der aber mit Politik, wie er selbst sagt, nichts am Hut hat. Den auch nicht wirklich interessiert, was die Militärjunta in Argentinien tatsächlich getan hat, wie viele Menschen sie auf dem Gewissen hat und wie sie nun mit der Fußball-WM versucht, ihr Image weltweit aufzupolieren.
Der Schatten des Deutschen Herbstes
Doch 1978 – das ist auch kurz nach dem Deutschen Herbst, in dem die Anschläge der RAF die Bundesrepublik in Atem hielten und sich nicht nur kluge Filmemacher/-innen die Frage stellten, was da eigentlich schiefgelaufen war und warum sich einige linke Gruppierungen derart radikalisieren konnten, dass sie nur noch mit Anschlägen und Entführungen glaubten, ihre Ziele erreichen zu können.
Ziele, die sie ja bekanntlich nicht erreicht haben. Im Gegenteil: Sie haben mit ihren Aktionen geradezu die Vorlage dafür geliefert, dass der Staat sich gegen „den Terrorismus“ aufrüstete und der „linke Terror“ mittlerweile zum Standardvokabular des konservativen Establishments geworden ist – angewendet ja seit Herbst 2022 auch gegen junge Leute, die sich aus Protest einfach auf die Straße kleben.
Aber darum ging es Bolten in seiner Geschichte nicht. Er fand die politischen Vorgänge um die Fußball-WM 1978 nur sehr vertraut, sah dasselbe Schema des Abwiegelns und Unpolitischseins, das auch 2022 bei der WM in Katar wieder zum Tragen kam. Und das macht natürlich ratlos, weil ja sichtlich nicht mal den sonst so ratschlagfreudigen Kommentatoren der großen Magazine ein Rezept einfällt, wie man Fußballfunktionäre zu einer einigermaßen anständigen politischen Haltung bewegen kann.
Also: Was tun?
Bolten interessierte dabei natürlich auch, wie die Menschen ticken, die in so einer Watte-Situation einfach beschließen, zum Beispiel eine Entführung zu planen und dabei glauben, genug Druck in der Öffentlichkeit aufbauen zu können, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen. Was in diesem Fall erst einmal drei scheinbar ganz friedliche und vernünftige Frauen aus dem linken Milieu tun. Zeichen setzen ist ja immer irgendwie gut. Oder doch nicht?
Wo sind die Grenzen des politischen Aktionismus?
Das ist eigentlich das Frappierende an der Geschichte, die Bolten fast dokumentarisch aufblättert, dass sich die drei Frauen nicht einmal Gedanken darüber machen, wie die Sache eigentlich ausgehen soll und was sie für seelische Verletzungen mit sich bringen wird. Sie beschließen die Entführung des aufgehenden Fußballtalents Tommy Küpper, finden ein Verlies, wo sie ihn für ein paar Wochen einsperren können, finden auch zwei tatkräftige Männer aus der linken Szene, die ihnen helfen. Und dann holen sie den jungen Mann einfach aus seiner Wohnung, mitten aus den Trainingsvorbereitungen. Denn Tommy hat sich wirklich reingehängt und sich in den engeren Auswahlkreis für die WM vorgearbeitet.
Einen ähnlichen Fall gab es 1978 zwar nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Aber das Schema ist durchaus nachvollziehbar. Und es wirft auch Fragen für die Gegenwart auf. Denn wie beginnt eigentlich die Radikalisierung von ansonsten klugen und vernünftigen Menschen? In diesem Fall Frauen, die ja eigentlich etwas Gutes wollen, aber irgendwie kein Problem dabei haben, das Leben eines Menschen in Gefahr zu bringen.
Die Diskussionen in der Entführergruppe, was sie dem jungen Man im Keller eigentlich antun und wie viel Gewalt zulässig ist oder nicht, beginnen ja erst später, als die deutsche Mannschaft längst in Argentinien kickt und die Polizei nicht einmal Anzeichen zeigt, auf die Forderungen der Entführer eingehen zu wollen. Die Sache droht also völlig aus dem Ruder zu laufen.
Die Würde des Opfers
Und dabei spielt Tommy mit, das auch noch, als er weiß, dass seine große Chance, in Argentinien dabei zu sein, längst vorbei ist. Auch der Bundestrainer sieht sichtlich keinen Grund, sich auf die Forderungen der Entführer in irgendeiner Weise einzulassen. Eine durchaus nervenzehrende Entwicklung, denn natürlich fiebert man mit Tommy und seiner Freundin Andrea mit. Die beiden haben ja auch noch eigene Pläne fürs Leben.
Während einem die fünf Entführer/-innen relativ fremd bleiben. Auch wenn die Frauen am Ende tatsächlich so etwas wie Gefühle zeigen für den Jungen im Keller. Sie sind es auch, die letztlich entscheiden, die Sache ohne Eskalation zu beenden. Auch wenn Michael Bolten für die Leser/-innen seines Buches am Ende noch eine ganz böse Überraschung in petto hat.
Denn der Deutsche Herbst war nun einmal auch von einer um sich greifenden Hysterie geprägt. Ein Begriff, der zwar aus guten Gründen als veraltet gilt. Aber im Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff – anders als in der medizinischen Begrifflichkeit – eben nach wie vor ein Verhalten, das überzogen ist, von Panik und falschen Ängsten befeuert, den tatsächlichen Vorgängen völlig unangemessen. Was Wikipedia eben nicht wirklich zu fassen bekommt. Irgendwie fehlt es dort an wirklich sprachsensiblen Autor/-innen.
Hysterie in diesem Sinn macht blind, fixiert nur noch auf etwas Bedrohliches, ob es nun tatsächlich da ist oder nur eingebildet ist. Und sie sorgt dafür, dass Menschen – und in diesem Fall Männer – völlig überreagieren. Von den heutigen Medien, die in diesem Sinne Hysterie regelrecht schüren, müssen wir da gar nicht erst reden. Auch wenn die Folgen ebenso zu beobachten sind. Denn wer immerfort Ängste schürt und die Gefahren übertreibt, bringt nun einmal auch all jene unter Handlungsdruck, die eigentlich besonnen und zurückhaltend agieren sollten.
Die Rolle der Medien
Und auch wenn man die Frauen, welche die Entführung von Tommy Küpper planen, nicht wirklich versteht in ihrer kühlen Planung der Entführung und der Auswahl ihres Opfers, reagieren sie am Ende, nachdem die Wochen des Wartens so gar keinen Erfolg zeitigten, dennoch überlegt. Sie sind es nicht, die die Geschichte blutig ausgehen lassen. Was natürlich die Frage nicht klärt, warum sie überhaupt so selbstverständlich auf eine Entführung als politisches Mittel verfallen sind.
Aber diese Frage steckt ja in der kompletten Diskussion um den Deutschen Herbst und vor allem die Entwicklung davor. Und sie ist sogar noch älter und hat auch eine Menge mit der medialen Darstellung von Gewaltphänomenen zu tun. Das wird meist vergessen. Und auch Bolten blendet es – bis auf einige ins Spiel gebrachte Nachrichtensendungen – aus.
Aber er bemerkt es zumindest, dass es die Medien sind, die das Stimmungsbild im Lande prägen – und zwar vor allem die bildgebenden Medien, das Fernsehen vorneweg. Ein Medium in diesem Fall, auf das die Entführer keinen Zugriff bekommen – und damit auch keine Wirkmächtigkeit. Und auch andere linke Gruppen solidarisieren sich nicht, helfen also ihrerseits nicht, den Druck zu verstärken. Was andererseits auch ein Zeitbild ist, denn die Kritik am Auftritt der deutschen Fußballmannschaft in Argentinien ließen damals DFB und Politik völlig von sich abprallen und damit ins Leere laufen.
Und Katar 2022 hat gezeigt, dass sich an diesen Mechanismen bis heute nichts geändert hat.
Und zu den Zielen der Entführer gehört ja in Boltens Buch auch, die Missstände in der argentinischen Militärdiktatur auch in den großen Medien anzuprangern. Doch da ihnen das nicht gelingt, ist ihre Geschichte letztlich eine des Scheiterns, auch wenn gerade die drei Frauen hocherhobenen Hauptes aus der Geschichte gehen, ihre Niederlage eingestehen und eben nicht versuchen, mit Gewalt irgendetwas zu erreichen.
Das hat niemand verdient …
Aber was bleibt dann eigentlich von einem politischen Anliegen, wenn man es nicht in der Öffentlichkeit thematisieren kann? Kein Gehör findet? Was natürlich schwerer ist, wenn das auch noch mit einer Entführung gekoppelt ist. Was richtet das an oder ist das zwangsläufig Teil einer Radikalisierung einer Bewegung, die sich an den Rand und ins Nichtwahrgenommenwerden abgedrängt sieht?
Das sind natürlich Fragen, die Bolten nicht beantwortet. Wie die drei Frauen ihr Leben nach dieser Geschichte weiterleben, erzählt er ja nicht mehr. Aber er lässt die Geschichte sehr menschlich ausklingen, wenn er eine der drei Frauen am Ende verzweifelt schluchzen lässt: „Nein, das hat niemand verdient. Niemand.“
Auf einmal liegt die Wunde ganz offen, das Mitgefühl der drei Frauen, die so nüchtern eine Entführung geplant haben und doch nicht aufgehört haben, Verständnis für ihre Mitmenschen zu zeigen. Augenscheinlich anfangs versteckt hinter der Logik einer politischen Aktion, die ihre menschliche Dimension erst im Nachhinein zeigt. Dann, wenn es zu spät ist. Was einem in Bezug auf scheinbar logische politische Aktionen durchaus zu denken gibt. Wo ist die Grenze? Wo sagt einem schon das Bauchgefühl: Hier ist Schluss?
Was übrigens nicht nur für die Aktivisten gilt. Sondern auch für all jene braven Bürger, die dann so schäumend nach Gewalt und „hartem Durchgreifen“ rufen. Und Innenministern, die dem nur zu gern folgen. Verbale Gewalt neigt nur zu gern zur Eskalation. Und endet dann fast immer in solchen Szenen, die Boltens Buch beenden, das jetzt vielleicht im Umkreis von Fortuna Düsseldorf viele begeisterte Leser findet, auch wenn es einen talentierten Fortuna-Profi namens Tommy Küpper nie gab.
Michael Bolten „Comando Cordobazo“, EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 17,40 Euro.
Die den Stein zum Sprechen bringen: Eine Liebesgeschichte um den Naumburger Meister

Keine Frage: Mitteldeutschland ist ein historisches Pflaster. Burgen, Dome und alte Klöster laden nicht nur zum Besuch ein, sondern regen auch die Fantasie an und werden zu Schauplätzen von historischen Romanen, die versuchen, das Leben vor Jahrhunderten zu imaginieren. Der Naumburger Dom mit seinen Stifterfiguren ist dabei besonders beliebt. Das hat auch Michael Prager gereizt. Insbesondere die Uta. Die in seiner Erzählung zur Hildegard wird.
Eine Erzählung, die sich im Grunde um die Frage dreht, welche die Historiker nur zu gern beantwortet hätten: Wer war der Naumburger Meister? Man hat zwar seine Spuren von Frankreich, wo er mit den frühen Entwicklungen der Hochgotik in Kontakt kam, über Mainz, Naumburg und Meißen nachzeichnen können. Denn seine Skulpturen sind unverwechselbar und für ihre Zeit einzigartig.
Aber es war eben auch eine Zeit, in der Künstler sich noch nicht namentlich auf ihren Kunstwerken verewigten. Ihre Werke entstanden als Teil eines Gesamtkunstwerks im Dienste Gottes. Auch wenn die Auftraggeber wohl ihre Namen kannten und ihnen auch Extra-Aufträge erteilten.
Namentlich bekannt sind meist nur die Bauherren – wie etwa Bischof Dietrich II. von Meißen, der für jenen Westchor des Naumburger Domes verantwortlich war, in dem die berühmten Stifterfiguren stehen. Sein Grabmal im Dom hat wahrscheinlich auch der Naumburger Meister gestaltet.
Wer war das reale Vorbild?
Aber wie wird dieser begnadete Bildhauer greifbar? Wie alt war er, als er in Naumburg wirkte? Wahrscheinlich nicht so jung wie der Held in Pragers Erzählung, die zuallererst eine Liebesgeschichte ist. Denn natürlich stellen die Stifterfiguren nicht ihre realen Vorbilder dar, die 200 Jahre vor dem Bau des Westchores lebten und herrschten. Der Bildhauer konnte auch auf keine Bildnisse zurückgreifen, die das Antlitz der Stifter über 200 Jahre bewahrt hätten.
Also war er gezwungen, aus seiner Fantasie zu schöpfen. Oder aus dem realen Leben. Was wohl eines der wichtigsten Arbeitsmerkmale des Naumburger Meisters war. Gerade das macht seine Arbeiten so lebensnah und lässt die Besucher des Doms noch heute ehrfürchtig hinaufschauen zu Ekkehard und Uta, Hermann und Reglindis – und viele dabei ganz bestimmt der Überzeugung, dass Uta so ausgesehen haben muss.
Aber vielleicht war sie nur eine Bürgerstochter aus Naumburg? Vielleicht sogar eine junge Frau, die sich als Prostituierte durchschlagen musste? Denn das Leben im Mittelalter war hart, der Absturz in Armut immer nahe, wenn die Eltern starben und die Verwandten nicht wirklich helfen wollten. Gar eine böse Base das hübsche Kind mit ihrem Zorn verfolgt.
Man merkt: Das Grundschema der Geschichte ist das Märchen vom Aschenputtel. Auch wenn der Prinz in dieser Geschichte der junge Bildhauer Christian ist, der in der schönen Hildegard seine junge, schöne Frau Katharina dargestellt hat.
Denn natürlich finden sie sich in dieser Geschichte – der Bildhauergeselle, der sich seinem Meister erst beweisen muss und an seinen Fähigkeiten zweifelt, und die junge Frau aus der Obhut des Naumburger Scharfrichters.
Auffällig natürlich dieses Zweifeln und Ungenügen des jungen Bildhauers. Der Held, der seinen eigenen Fähigkeiten nicht traut. Aber auch das kennt man aus der Topografie des modernen historischen Romans, mit seinen tapferen Helden aus kleinen Verhältnissen, die nur davon träumen können, die Prinzessin jemals besitzen zu können. Doch Christian bekommt seine Katharina. Und verliert sie auch wieder. Was nutzen Schönheit und Klugheit, wenn die Schönen dann doch bei der Geburt der Kinder sterben?
Ein lebendiges Bild
Dass die Geschichte natürlich vor allem Fantasie ist, betont Prager extra. Weshalb er Naumburg, die Schönburg (auf die er seinen Bischof Nikolaus im heißen Sommer ausweichen lässt), Unstrut und Saale genauso anonymisiert wie die Helden in seiner Geschichte, die in gewisser Weise auch eine Doppelgeschichte ist. Denn bevor er Katharina und Christian zueinander finden lässt, wird in der Person des Bischofs Nikolaus ja die Geschichte des realen Bischofs Engelhard erzählt, der den Bau des neuen Doms zu Naumburg begann, dessen Fertigstellung aber nicht mehr erlebte.
Ob es freilich am Hofe Engelhards tatsächlich so gesellig zuging, wie Prager es sich ausmalt? Wahrscheinlich eher nicht.
Aber man darf wohl berechtigterweise davon ausgehen, dass es für die Stifterfiguren tatsächlich sehr lebendige Vorbilder im damaligen Naumburg gab. Und Frauen wie Uta und Reglindis werden den Gesellen der Dombauhütte bei jedem Besuch auf dem Markt begegnet sein. Und vielleicht hat der damals längst schon erfahrene Naumburger Meister sich tatsächlich bei solchen Begegnungen gesagt: So soll meine Uta aussehen. So soll sie vom Pfeiler herabschauen.
Ob er dabei auch die staunende Nachwelt im Sinn hatte, weiß man nicht. Auch wenn sich die Mitglieder der Bauhütte sehr wohl dessen bewusst waren, dass sie für die Ewigkeit bauten und Bauwerk und Kunstwerke eine beeindruckende Einheit bilden sollten, die auch Platz für das Leben ließ. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass die Stifterfiguren auch die Herrschaft aus der Zeit von 1250 würdigten, als der Naumburger Meister tätig war. Und die Veranlassung zum Bau des Westchores gab ja Heinrich III. von Meißen.
Wenn Uta wichtiger ist als der Marienaltar
Und der Meißner Dom war die nächste Station auf dem Weg des Naumburger Meisters. Er bildete hier also auch die sehr aktuelle Würdigung des erlauchten Markgrafen von Meißen ab. Aber wie es wirklich war und wie der Naumburger Meister an den Stiftergestalten arbeitete, werden wir nie erfahren. Das können sich nur Autorinnen und Autoren ausmalen, die versuchen, sich fantasievoll in diese Zeit hineinzuversetzen.
Oder eben wie Michael Prager in dem Wunsch, der Region ein kleines Denkmal zu setzen, in der er aufgewachsen ist und deren Geschichten ihn auch in Leipzig, wo er unter bürgerlichem Namen lebt, nicht loslassen. Und es stimmt ja: Allein schon die vielen Geschichten um die schöne Uta locken Jahr für Jahr Hunderttausende nach Naumburg. Und sie sind einer der Gründe dafür, warum der Streit um die Aufstellung des von Michael Triegel ergänzten Marienretabels von Lukas Cranach im Westchor des Naumburger Doms so hochgekocht ist. Man möchte ja nicht auf die freie Sicht auf Uta und Reglindis verzichten.
Michael Prager „Die den Stein zum Sprechen bringen“, EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 15,40 Euro.
Der Steinmetz und die Hure
KULTUR Der aus Teuchern stammende Autor Michael Prager hat einen historischen
Roman vorgelegt. Er spielt in einer mittelalterlichen Stadt mit Dom: Naumburg.
VON ALBRECHT GÜNTHER
NAUMBURG
Soeben ist im Saale-
Unstrut-Jahrbuch ein bemer-
kenswerter Aufsatz über die stei-
nerne Stifterfigur Uta erschienen,
da liegt bereits die nächste Veröf-
fentlichung vor, in welcher der
Dom und die Stadt Naumburg ge-
wissermaßen Hauptschauplätze
sind. Dabei jedoch handelt es sich
um einen historischen Roman:
„Die den Stein zum Sprechen
bringen“. Vorgelegt im Leipziger
Verlag „Einbuch“ hat ihn der aus
Teuchern stammende Autor Mi-
chael Prager.
Er kennt Naumburg sehr ge-
nau, hat aber die Stadt und den in-
zwischen zum Unesco-Welterbe
gehörenden Dom anonymisiert.
So taucht der Name Naumburg im
Buch niemals auf. Der Leser indes
wird schnell merken: Jene mittel-
alterliche Stadt mit ihrer Bi-
schofskirche kann kaum eine an-
dere sein.
Die Handlung siedelt Prager in
der Mitte des 13. Jahrhunderts an.
Eine Erweiterung der Bischofskir-
che um den West-Chor ist geplant,
die Bischof Nikolaus noch in sei-
nem hohen Alter auf den Weg
bringen will. Der von ihm vor 30
Jahren angeregte Bau soll damit
einen weiteren repräsentativen
sakralen Raum erhalten. Doch die
Dinge brauchen ihre Zeit.
So ist der Bischof bereits tot, als
der Steinmetzmeister Stephan
aus dem fernen Mainz mit seinem
Gefolge in der Stadt Einzug hält
und die Arbeiten schließlich be-
ginnen. Mit dabei ist der junge
und talentierte Steinmetzgeselle
Christian, der sich in der Stadt
niederlässt, sich in die schöne Ka-
tharina verliebt und nichts mehr
möchte, als mit dieser ein ganz
normales Leben zu leben.
Doch schon zu Beginn zeigt
sich, dass das nicht einfach sein
wird. Denn Katharina, früh zur
Waise geworden, nachdem erst
die Mutter an einer Blutlauf ge-
nannten Krankheit zunächst lei-
det und später daran stirbt, hat
ein schweres Schicksal. Hinzu
kommt: Ihr Vater wird auf der
Dombauastelle von einem Stein
erschlagen. So wird Katharina –
von der nur scheinbar sich sor-
genden Stiefmutter betrieben –
ins Frauenhaus verschleppt, in
dem sich der Frauenwirt und
Henker der Stadt um die soge-
nannten Hübschlerinnen küm-
mert, Frauen, die den Männern
ihren Körper gegen Bezahlung zur
Verfügung stellen. Keineswegs
eine Schande zu jener Zeit, aber
alles andere als die optimale Vo-
raussetzung, mit dem Liebsten in
eine dauerhafte Beziehung zu tre-
ten. Und so braucht es nicht nur
Zeit, sondern auch Überwindung,
bis sich Katharina und der Stein-
metz finden und lieben lernen.
„Die den Stein zum Sprechen
bringen“ ist nicht das erste Buch
des Autors Michael Prager, wohl
aber sein erster Roman und eben
ein historischer. Mit ihm dringt
Prager ein in die Welt der Stein-
hauer- und -setzer und lässt durch
diese tatsächlich das Gestein spre-
chen. „So erfährt der Leser jede
Menge über das Bauen, das Arbei-
ten, das Lieben und Leben in
einer Zeit, die in den Erzählun-
gen, in der Geschichte als eine
dunkle, ja finstere Zeit gilt, eine
Zeit voller Mühsal und Schufterei
mit bloßen Händen, von Seuchen,
Krankheiten und frühem Tod“,
heißt es in einer vom Verlag veröf-
fentlichten Pressemitteilung.
„Der Autor erzählt nicht nur,
wie Kathedralen des Glaubens
über Jahrzehnte, oft über Jahr-
hunderte entstehen, welche welt-
lichen Fäden dabei gesponnen
werden, wie bestochen und intri-
giert wird, wie der Adel sein
Selbstbild, seinen Egoismus und
Narzissmus befördert, wie Posten
verschoben werden und Men-
schen aus dem Weg geräumt, nur
damit die Reicheren und Hinter-
triebeneren letztlich Teil der Ge-
schichte sein dürfen, nein, Prager
lässt seine Helden sich auch im
Sonnenlicht an der blauen Saale
treffen, lässt sie sich küssen, lässt
sie lachen und tanzen.“
Es ist also auch viel Licht in
dieser Mittelaltergeschichte. Und
vielleicht regt sie damit den einen
oder anderen Leser an, der Naum-
burg und den Dom noch nicht
kennt, in Bus, Zug oder Auto zu
steigen, um sich die Steine anzu-
sehen, die möglicherweise ein ta-
lentierter Steinmetzgeselle mit
dem Namen Christian säuberlich
geschlagen und gesetzt und dabei
an seine Katharina gedacht hat.
›› Der Roman „Die den Stein zum
Sprechen bringen“ ist für 15,40 Euro er-
hältlich bei www.bücherfairkaufen.de
oder im Buchhandel.
Modellversuch Chemnitz: Der tragische Tod des Journalisten Arne Heller
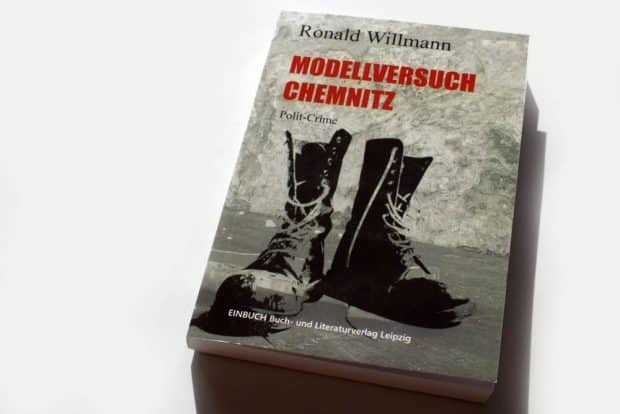
Ronald Willmann: Modellversuch Chemnitz. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserEs ist ein vertrackter Roman, freilich nicht unbedingt, weil der Held stirbt darin wie der Held in William Goldings „Pincher Martin“ von 1956. Das ist lediglich erschütternd, vertrackt ist er, weil er ein Stück weit die Wehrlosigkeit von Journalisten zeigt, die wirklich herausfinden wollen, wer im deutschen Rechtsextremismus tatsächlich die Fäden zieht und welche Rolle dabei die seltsamen Ämter für Verfassungsschutz spielen, die so erwartbar immer wieder versagen, wenn es um rechtsextreme Umtriebe geht.
Wer beim Titel „Modellversuch Chemnitz“ an die Ausschreitungen im Sommer 2018 denkt und an den seltsamen Schulterschluss der rechten Populisten mit den rechtsradikalen Kameraden, liegt freilich ein wenig daneben, auch wenn das, was sich da binnen weniger Stunden entwickelte, durchaus den Charakter eines Modellversuchs hatte. In dieser Form hatten rechtsradikale Strippenzieher in jüngster Zeit noch nicht versucht, in kurzer Zeit tausende Rechtsradikale zu mobilisieren und ein Tötungsdelikt zu einer öffentlichen Machtdemonstration zu nutzen.
Aber in Willmanns Geschichte geht es um eine andere Art Modellversuch, einen, der eigentlich seit Jahrzehnten läuft und den die Öffentlichkeit als V-Mann-Affären kennengelernt hat – immer dann, wenn die vom Verfassungsschutz angeworbenen Rechtsextremisten außer Kontrolle geraten und auf einmal zu den Anstiftern wirklich krimineller Anschläge und Machenschaften geworden sind.
So war das in Thüringen, als sich dort die Terrorgruppe Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe gründete, so war das mutmaßlich auch während der Anschläge, die Mundlos und Böhnhardt verübten. Immer wieder tauchen obskure Verbindungsmänner auf, die angeblich nichts mitbekommen haben, aber mitten in den rechtsextremen Seilschaften agierten. Und wenn Untersuchungsausschüsse deren Führungsbeamte vorladen, wissen die von nichts, berufen sich auf den Schutz ihrer V-Leute oder lassen gleich mal meterweise die Akten zu den Vorfällen schreddern.
Das gibt Raum für Mutmaßungen. Und Misstrauen. Ein Misstrauen, das Ronald Willmann teilt. Denn sein Held, der junge Journalist Arne Heller, stirbt nicht, weil er so mutig war, Mitglied einer rechtsradikalen Clique zu werden (die im Nachhinein ein wenig an die Gruppe „Revolution Chemnitz“ erinnert), sondern weil diese Schlägertruppe mit eigentlich ziemlich desorientierten jungen Männern Spielfeld von allerlei Leuten wird, die hier von außen steuern und ihr eigenen Süppchen kochen.
Denn Hellers Chefredakteur Rolf Bleiser hat natürlich recht, wenn er Heller vor seinen Undercover-Recherchen warnt und am Ende der etwas zwiespältigen Sabrina gegenüber noch einmal erklärt: „Sie sind kein basisdemokratisch unorganisierter Haufen mit gleichberechtigten freien Meinungen. Straff organisiert versuchen sie, Anarchie in die Gesellschaft zu tragen. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Denken abnimmt und die Richtung vorgibt. Was sie gern als Treue heroisieren, ist in Wirklichkeit nichts weiter als tumber Kadavergehorsam. Wer den in dieser Weise bis zur Perfektion exerziert, der ist geradezu prädestiniert für eine Steuerung von außen.“
Sabrina ist dabei einerseits diejenige, die Heller in ihrer Tarnung als Sozialarbeiterin den Zugang zur Gruppe ermöglicht, andererseits aber eigentlich für den Verfassungsschutz arbeitet, sozusagen als V-Frau in der Gruppe. Aber auf ihre resolute Art fasziniert sie Heller auch, sodass der am Ende eine Menge Warnsignale übersieht, weil Liebe nun einmal blind macht.
Aber es gibt mindestens noch einen weiteren V-Mann in der Gruppe. Und es gibt zwei ältere Herren in zwei verschiedenen Verfassungsschutzämtern, die hier um ihre Eingriffshoheit buhlen und von denen mindestens einer auszuprobieren versucht, wie sich so eine Kloppertruppe von außen steuern lässt. Was natürlich am besten gelingt, wenn der eigene V-Mann das Zeug zum Anführer hat. Oder zum Verführer und Strippenzieher
Was logischerweise auch die beste Voraussetzung dafür ist, dass genau dieser Bursche dann eigene Initiativen entwickelt, sein Image mit wirklich brutalen Aktionen aufzupolieren und die ganze Gruppe zu radikalisieren.
Was Heller ahnt und was zum Seitenstrang seiner Recherchen wird, ist die Tatsache, dass just dieser heimliche Kopf der Truppe der Sohn eines in der Stadt bekannten Promi-Anwalts ist, dessen Vorleben in der DDR ganz und gar nicht bieder und staatsfern war. Da ahnt Arne Heller wohl, dass er in ein richtiges Wespennest geraten ist, aber nicht, woher die Gefahr wirklich droht. Und auch Sabrina ahnt es viel zu spät, dass auch ihr strebsamer Vorgesetzter im Verfassungsschutz seine eigene Spielchen spielt – und das auf höchst dilettantische Weise.
Je länger man dem Leiden des schwer zusammengeschlagenen Journalisten zuschaut und mit ihm die Entwicklung bis zu dieser dramatischen Nacht verfolgt, umso mehr verwandelt sich die Geschichte, wird deutlich, dass es eigentlich nicht die tausendste Skinhead-Story sein kann, die in der Zeitung wieder für Aufsehen sorgt. Denn an den Skinheads in der rechten Szene ändert sich nichts. Da sind keine Geheimnisse, ist kein Mythos. Und die Weltsicht dieser oft genug völlig orientierungslosen jungen Männer bleibt so platt und dumm, wie sie auch vorher schon war.
In so einer Truppe fällt ein neugierig herumfragender Undercover-Journalist auf wie ein Paradiesvogel unter Hyänen. Und auch wenn Willmann seinen Chefredakteur am Ende die Bedenken eher kleinreden lässt – die schlichte Wahrheit ist, dass sich die Redakteure von Regionalzeitung hüten würden, selbst ihre jüngsten Mitarbeiter einer solchen Gefahr auszusetzen. Selbst für Undercover-Recherchen braucht es andere Absicherungen. Hier sind eine ganze Reihe Leute so naiv unterwegs, dass es eigentlich schiefgehen muss.
Aber auch wenn es die Nazi-Kumpel sind, die am Ende zuschlagen, ziehen andere die Strippen. Und im letzten Gespräch zwischen Sabrina und Rolf Bleiser wird endgültig klar, dass die Geschichte tatsächlich das unheilsame Wirken der Verfassungsschutzämter diskutiert, die als „Frühwarnsystem der Demokratie“ regelmäßig versagen.
Wobei Willmann eine ganz gemeine Frage stellt: Kann es sein, dass sie sich sogar erst die immer neuen Anlässe schaffen, ihre Existenzberechtigung zu untermauern? Eine ganz böse Frage, ich weiß. Aber nicht nur in Sachsen sträuben sich die Innenministerien, die Landesämter für Verfassungsschutz zu reformieren, ihre Arbeit transparenter und nachvollziehbarer zu machen.
Und das macht die von Willmann geschilderten Selbstermächtigungen einzelner Beamter durchaus wahrscheinlich.
Was nutzen all die warmen Worte und öffentlichen Tränen zu immer neuen rechtsradikalen Anschlägen, wenn das Frühwarnsystem nicht funktioniert, Millionen für einen Apparat ausgegeben werden, der seine Informationen (wenn er sie denn hat) nur ungern weitergibt an Polizei, Staatsanwaltschaft und Kommunalverwaltungen, die mit dem braunen Spuk regelrecht alleingelassen werden? Von Politiker/-innen ganz zu schweigen, die die Aggressionen der Rechtsradikalen mit voller Wucht abbekommen, in den zuständigen Innenministerien aber bestenfalls schöne Versprechungen bekommen, man ermittele ja mit aller Kraft.
Doch wenn dann einzelne rechtsradikale Schläger vor Gericht landen, bekommen sie oft erstaunlich niedrige Strafen oder kommen gar ungeschoren davon, ganz so, als hielte jemand seine schützende Hand über sie, sodass sie draußen weiter für Bedrohung und Einschüchterung sorgen können.
Auch wenn wohl keine sächsische Regionalzeitung ihre jungen Redakteure je so zu einer wirklich gefährlichen Undercover-Recherche schicken würde, wetterleuchtet in diesem Buch der verstörende Umgang sächsischer Behörden mit den rechtsradikalen Netzwerken im Land, der seit Jahren – und nicht erst seit dem seltsamen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos 2011 – lauter Fragen aufwirft, ohne dass die zuständigen Ämter auch nur ansatzweise schlüssige Antworten vorlegen.
Und Willmanns dezenter Hinweis, den er ebenfalls Bleiser in den Mund legt, dass eigentlich die Medien die ganze Zeit die Arbeit machen, die man vom Verfassungsschutz erwarten könnte, ist sehr real. Auch wenn es eher freie Journalisten sind, die sich in den vergangenen Jahren die nötige Kompetenz aufgebaut haben, im rechtsradikalen Milieu investigativ zu arbeiten.
Und die dann die Ergebnisse ihrer Recherchen in Büchern veröffentlichen, die eigentlich eine Mahnung sein müssten. 2016 hatten wir einmal die wichtigsten dieser Bücher in einem Artikel versammelt. Aber geändert hat sich bis heute wenig. Untersuchungsausschüsse gingen mit enttäuschenden Ergebnissen zu Ende. Und oft brauchte es erst den Zugriff der Bundesstaatsanwaltschaft, damit einige der kriminellsten rechten Vereinigungen in Sachsen überhaupt zum Fall fürs Gericht wurden.
So gesehen ist Willmanns Roman natürlich ein politischer Krimi, auch wenn er nicht wirklich auch Parteienvertreter ins Bild bringt. Aber Politik ist eben auch, wie staatliche Behörden funktionieren, ob sie die Standards des Rechtsstaats wahren oder sich verselbständigen und auf einmal die Frage im Raum steht, wem sie tatsächlich dienen.
Willmann Ronald Modellversuch Chemnitz, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro.
Kavalier: Eine Münchner Studie zur komplizierten Partnersuche in anspruchsvollen Zeiten
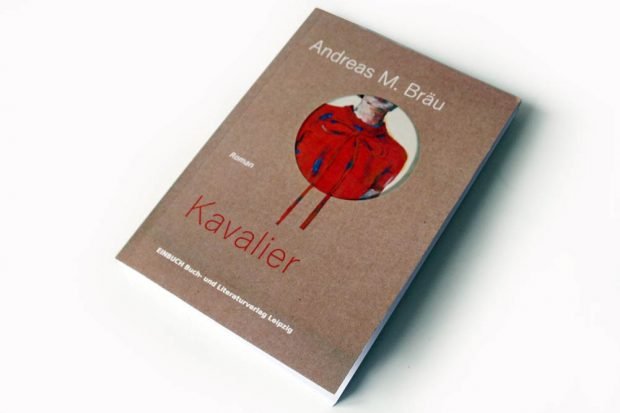
Andreas M. Bräu: Kavalier. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserNein, ein Roman ist das eigentlich nicht, auch wenn es draufsteht und der Münchner Autor Andreas M. Bräu hier sein Debüt im längeren Genre vorlegt. Eher ist es eine Studie, so etwas, was Autoren wie Balzac und Flaubert dereinst als Stilübung veröffentlichten. In diesem Fall: eine Studie über die Partnerwahl junger Münchner in Zeiten der radikalen Erwartungen an den perfekten Partner. Eigentlich die ideale Voraussetzung dafür, dass überhaupt niemand mehr einen Partner zum Leben findet.
Wobei Bräu ja nichts Unrealistisches schildert, wenn er Tim und Marianne in parallelen Handlungen auf die Suche gehen lässt. Ganz ähnlich läuft das ja heute tatsächlich ab in allen deutschen Universitätsstädten. Oder vielleicht doch vorsichtiger formuliert: So lief es vor Corona ab, als alle Szenekneipen noch ohne Einschränkungen geöffnet waren, sich die jungen Leute in Bars, Freisitzen und Tanzlokalen treffen konnten, um andere junge Leute kennenlernen, sich verabredeten und dabei Unmengen von Alkohol in sich hineinschütten konnten.
Und manch Leserin und Leser wird sich wiedererkennen in dieser frühen Not, die sich gerade in Tims Kopf abspielt wie eine ununterbrochene Prüfung mit Fragen, die kein Mensch wirklich beantworten kann. Die aber zu unserer Gegenwart gehören, in der auch die Partnersuche der Menschen sichtlich zum Spielfeld einer gnadenlosen Be- und Verwertungslogik geworden ist. Und das nicht nur in Online-Portalen. Wer das glaubt, wäre naiv.
Die Matrix steckt in der Werbung mit völlig überzogenen Schönheitsidealen, in verlogenen Filmserien, auch in Medien – und zwar nicht nur Boulevardmedien. Stapelweise erklären Ratgeberbücher, wie man den idealen Partner findet, wie man richtig auf Partnerfang geht, wie man sich kleiden, schminken und fit machen muss für einen gnadenlosen Wettbewerb um Mister Right oder das Superweib. Wie man seine (Wettbewerbs-)Chancen, seine Flirt-Qualitäten und Bettkünste verbessert. Das Gespenst sitzt in den Köpfen der jungen Menschen. Und das Ergebnis ist: In diesem Buch ist niemand gelassen.
Auch Marianne nicht, obwohl sie gerade ihre lange Partnerschaft mit Hannes beendet hat, den sie aus ihrer Heimatgemeinde mitgebracht hat nach München zum Studium. Aber irgendwie ist aus dieser Partnerschaft die Luft raus. Marianne ist also da, wo ihre Freundinnen schon lange sind: solo und auf der Suche nach dem Burschen, der sie wirklich glücklich macht. Oder wenigstens die Anlagen dazu hat. Auch wenn das Marianne eigentlich nicht liegt.
Sie erwartet von den Männern wirklich mehr als eine gute Leistung im Bett, auch wenn sie nach dem Zusammenleben mit Hannes nicht so recht weiß, was es eigentlich ist. Nur eins merkt man schnell: Sie zieht Grenzen, ist schnippisch, fordert heraus und liebt es, auch Männern die Wahrheit ins Gesicht zu sagen.
Wenn alle Frauen so wären …
Es wäre anders. Und wohl auch weniger rührselig, weniger von all diesen abgesehenen und angelernten Rollenspielen geprägt, in denen die beiden Geschlechter irgendwie versuchen, irgendwelchen falschen Erwartungen aus verlogenen Filmen zu genügen. Und am Ende dann doch bei den Falschen landen, in unaushaltbaren Leben, in denen man dann schlecht kaschiert, wie unwohl man sich darin befindet.
Und Tim? Der liegt auch noch mit seinem Studium über Kreuz, er möchte ja gern ein guter Pianist werden, aber nicht so ein klassisch durchtrainierter, wie es sich sein Prof. vorstellt, um dann mit anderen hochtrainierten Mitbewerbern um die raren Stellen in der klassischen Musik zu buhlen. Er spielt schon längst in Münchner Bars, wo er seiner Freude am Jazz freien Lauf lassen kann. Und seine Vorstellungen von der richtigen Frau hat er ausgerechnet aus der Oper: Keine hat ihn je so beeindruckt wie die Marschallin im „Rosenkavalier“.
Entsprechend misstrauisch geht er mit all den Begegnungen mit den jungen Frauen um, denen er bei den nächtlichen Streifzügen durch Schwabing mit seinem Freund Beni begegnet, Frauen, die augenscheinlich nur zu gern bereit sind, mit dem Burschen etwas anzufangen. Doch selbst wenn er sich mit ihnen trifft, stellt sich schnell das Gefühl ein, dass er diese Beziehung nicht wird durchhalten können. Selbst sein Lieblingscafé riskiert er auf diese Weise.
Man wundert sich nur, dass Geld für ihn scheinbar überhaupt kein Problem zu sein scheint. Augenscheinlich nimmt uns Bräu hier mit in die Welt der gut versorgten Kinder eines wohlhabenden Mittelstandes, die sich auch leisten können, ein Studium in einem Fach aufzunehmen, das später nicht wirklich einen handfesten Broterwerb verspricht.
Die sich auch um die Preise für die Getränke in den angesagten Bars nicht kümmern müssen, die auch nicht in WGs leben müssen. Zeichen, die man nicht übersehen darf: Dieser ganz spezielle Partnersuch-Stress ist der Stress der oberen Mittelklasse, die gern so tut, als wären ihre Maßstäbe die Maßstäbe für alle. Obwohl es keine Maßstäbe sind, sondern Preisschilder.
Uneingestandene Preisschilder.
Natürlich hat jeder Mensch seine Vorstellungen von dem Menschen, den er im Leben gern an seiner Seite hat.
Das ist aber nur das eine.
Fast alle stolpern wir irgendwann darüber, dass es bei Liebe, Sex und Vertrauen munter durcheinandergeht, dass man sich gerade in den hormonbefeuerten Jahren oft in die oder den Falsche/-n verliebt und trotzdem gar nicht anders kann, weil die Natur das so eingerichtet hat. Der sind unsere gesellschaftlichen und kulturellen Standards völlig egal. Die lässt Weibchen und Männchen geradezu blind agieren in dieser Zeit.
Und wer sich wirklich erinnert, wie das war, der weiß das auch. Und ist, wenn er ehrlich ist, froh, wenn er oder sie heil aus diesem Schlamassel herausgekommen ist und irgendwann so wach war, die anderen auch noch nach etwas anderem einzuschätzen als nur dem Feuerwerk im Bett, im Heu oder auf der Rückbank des Autos.
Ein wenig davon glimmt in diesem Tim, den man stellenweise zum Mond schießen könnte, wenn er die nächtlichen Ausflüge nur zum Besaufen nutzt und dann Marianne auch noch besoffene Tweets schickt.
Aber anders als selbst seinem Freund Beni geht es ihm nicht um „Eroberungen“. Er hat tatsächlich den Wunsch, dass die Frau, die er sucht, ihm erwachsen begegnet, ihn ernst nimmt und ihn fordert. Dass er ausgerechnet die Marschallin als Vorbild sieht, verwundert einen vielleicht nur, wenn man kein Richard-Strauß-Verehrer ist. Bei Tim hat das auch mit der Musik zu tun. Man möchte nicht sein Wohnungsnachbar sein, wenn er die Musik voll aufdreht.
Und natürlich treffen sich die beiden irgendwann. So, wie sich Menschen treffen, wenn sie tatsächlich offen für diesen Moment sind, in dem einem das Gesuchte und Vertraute unverhofft doch noch begegnet. Das, was einen am anderen Geschlecht wirklich immer fasziniert hat und was mit „verwandte Seele“ so schlecht beschrieben ist.
Mit „auf gleicher Wellenlänge“ eigentlich auch. Denn für Tim hören ja die Irritationen nicht auf, obwohl er sich mit der schlagfertigen Marianne so wohl und herausgefordert gefühlt hat wie mit noch keiner Frau. Auch nicht mit der tapferen Gloria, die so vollkommen das Bild von der passiv Erwartungsvollen erfüllt hat.
Mensch, Mädchen, möchte man dazwischenrufen: Mach dich doch nicht so abhängig von den Kerlen! Es ist dein eigenes Leben!
Aber da würde man wohl verleugnen, wie verlogen unsere Gesellschaft nach wie vor ist und dass die alten Stereotype und Machtverhältnisse immer noch weiterwirken, trotz #metoo und aller Emanzipation: Frauen haben keine Chance, ein gleichberechtigtes Leben zu leben, wenn sich die Kerle mit den dicken Hosen und Portemonnaies nicht endlich emanzipieren. Wobei ich wieder bei den oben skizzierten Bildern aus Film und Fernsehen bin: Es ist das anschmiegsame Weibchen, das dort promotet wird, die (blonde) Schöne, die alles tut, um dem Affenmännchen zu gefallen.
Deswegen kann man Tim am Ende eigentlich nicht wirklich böse sein, weil er in seinem Fall ehrlich ist – und auch ehrlich leidet, als Marianne sich tagelang nicht meldet. Das stürzt jeden Mann in tiefste Verzweiflung, der sich wirklich verliebt hat. Erst recht, wenn er weiß, dass solche Frauen wie Marianne selten sind. Und noch viel seltener ausgerechnet dort, wo man nach ihnen sucht.
In gewisser Weise ist es also eine Liebesnovelle, die diesmal nicht – wie man das von Flaubert oder Maupassant kennt – tragisch scheitert. Und die auch nicht so ausgeht wie in Balzacs sarkastischen Analysen des Ehelebens. Die beiden bekommen ihre Chance, die Studie geht optimistisch aus. Ob sie es danach auch noch schaffen, wissen wir nicht. Da gilt auch in diesem Fall das Resümee aus Kurt Tucholskys Gedicht „Danach“: „Und darum wird beim happy end / im Film jewöhnlich abjeblendt.“
Und nicht nur im Film.
Andreas M. Bräu Kavalier, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro
Die fremde Ausländerin: Eine Kriminalgroteske, die ganz zufällig in der österreichischen Provinz spielt

Paul Braunsteiner: Die fremde Ausländerin. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserDer Österreicher Paul Braunsteiner ist Maler, Musiker, Filmemacher, Schauspieler und auch Autor. Einer, der sich in seiner Lust am Kunstmachen nicht bremsen mag. Und der ein mittlerweile sehr angespanntes Verhältnis hat zu dem, was einem in deutschsprachigen Landen so als Krimi vorgesetzt wird, egal, ob als Buch oder als Abendfilm, wo Kommissare auch noch in der entlegendsten Provinz agieren, als wären sie ein Klon von Inspektor Columbo, mufflige Supergehirne, die mit stereotypen Sprüchen davon ablenken, dass sie den Täter längst im Visier haben.
Vielleicht ist das so. Aber Braunsteiners Krimigroteske, die er im Leipziger Einbuch Verlag veröffentlicht hat, spielt eindeutig mit diesem Überdruss an den Tatorten und Sokos, mit denen öffentlich-rechtliche Sender die Pantoffelkinos beglücken. In denen die Drehbuchschreiber immer wieder dieselben Phrasen verwenden, dieselben Dramaturgien, dieselbe Dramatik, gern auch mit dramatischer Orchestermusik unterlegt, sodass man durchaus das beklemmende Gefühl bekommen kann, in einem Land finsterer Mächte und allgegenwärtiger Todesgefahr zu leben.
Und die Leute ziehen sich das Zeug rein, die großen Magazine schreiben dramatische Besprechungen, die ahnen lasen, dass die hochbezahlten Redakteure wohl tatsächlich ganze Abende vor der Glotze verbringen.
Das verändert natürlich die Weltsicht. Auch die auf das, was man so Provinz nennen kann, in der Krimis schon mal zum Heimatfilm werden und die dort Lebenden zu Exoten mit komischer Sprache. Stereotype funktionieren im Fernsehen immer wieder. Sie sind so schön zum Bedudeln. Also setzte sich Braunsteiner hin und schrieb das absolute Gegenteil eines üblichen Krimis. Er bezeichnet das, was er den zum Urlaub in einem Nest namens Untergestäng weilenden Oberhauptkommissar Brunzer erleben lässt, als Kriminalgroteske.
Und er verzichtet auf keine Gelegenheit, seine ermittelnden Polizeier – neben Brunzer auch noch die beiden Dorfpolizisten mit den sprechenden Namen Festnehmer und Einbuchter und seine beiden herbeizitierten Assistenten aus der Stadt – zu überzeichnen und die allwissende Klugscheißerei aus den Gutenachtkrimis zu persiflieren.
Insbesondere seinen Oberkommissar lässt er sich aufplustern wie ein Pfau, dem die eigene Genialität zu Kopf gestiegen ist. Und die Autorität seines Titels erst recht. Immer wieder kombiniert er vor versammelter Mannschaft gnadenlos logisch, wer jetzt gerade der Täter gewesen sein musste und mit welchem üblichen Mordinstrument er zu Werke gegangen sein muss (weil das so im Polizeihandbuch steht).
Und eigentlich liegt er jedes Mal gründlich daneben, wird aber für seine genialen Zirkelschlüsse allseits bewundert. Was echten Kommissaren im normalen Polizeialltag in der Regel nicht geschieht. Berühmt und bejubelt werden nur Fernsehkommissare. Meistens für ihre Kauzigkeit und ihr misstrauisches Grunzen.
Die meisten der von Brunzer als Täter Identifizierten liegen dann ein wenig früher oder später tot in der Gegend herum. Auf die meisten Anforderungen, die man bei der Tatortuntersuchung erwartet, verzichtet der urlaubende Kommissar kurzerhand, der die Ermittlungen an sich zieht, aber über seine Ansichten und Einsichten am liebsten vor großem Publikum im Dorfgasthof räsoniert, ohne dass auch nur ein Fünkchen mehr Erkenntnis über die jeweils zu Tode Gebrachten dazukommt.
Und man stolpert auch noch über einen zweiten Effekt, mit dem schlechte Drehbuch- und Krimischreiber versuchen, ihre lahme, weil nicht erlebte Geschichte mit Dramatik aufzupeppen. Denn für gewöhnlich droht der Täter ja der Polizei durch die Lappen zu gehen, weil sie zu langsam ermittelt. Die Zeit läuft, die Filmminuten schmelzen weg.
Aber in Untergestäng geht alles geruhsamer zu. Der Tagesablauf ist streng geregelt. Mittags und abends findet sich das halbe Dorf pünktlich im Dorfgasthof ein, lässt alles stehen und liegen, was eben noch getan wurde. Und auch Brunzer und seine anbetenden Helferlein handeln genau so. Kaum haben sie sich bemüht, einen der Tatorte aufzusuchen, läutet schon wieder die Mittagsglocke.
Sie reden jede Menge, all dieses besserwisserische Zeug, mit dem Krimi-Publikum meist beeindruckt wird und das Expertentum vortäuscht, wo die Autoren in der Regel null Ahnung haben. Und kaum haben sie sich – gern auch im Dialekt – allerlei raunzige Phrasen an den Kopf geworfen, müssen sie schon wieder zur Abendtafel in den Gasthof. Kein Wunder also, dass die Tage verfliegen, Brunzers Urlaub sich abspult, die Leichen sich häufen und am Ende nicht mal mehr einer die Lust verspürt, sich die Hingemeuchelten überhaupt noch näher anzuschauen.
Braunsteiners Geschichte wird eine Art Reigen, in dem immer neue Gestalten mit sprechenden Namen auftauchen – und alsbald wieder aus der Handlung fallen, weil sie von einem Dorfbewohner tot aufgefunden werden. Gestandene Krimileser wird diese Geschichte regelrecht in den Wahnsinn treiben, vielleicht aber auch ermuntern, die geliebten Krimihelden mal mit etwas kritischerem Blick zu betrachten, all diese Superhirne, die selbst die vertracktesten Fälle mit ein paar logischen Kombinationen und Geistesblitzen lösen. Was in der Regel nicht funktioniert, weil auch Ganoven wissen, wie man trickst, falsche Fährten legt und die Gesetze so anwendet, dass emsige Polizisten hilflos vor verschlossener Tür stehen, weil sie keinen Durchsuchungsbefehl bekommen haben.
Und ein paar dieser cleveren Ganoven tauchen dann am Ende der Geschichte auch auf, ziemlich überraschend. Es sind ausgerechnet die cleveren Neureichen im Dorf – der Oberlehrer, der Versicherungsvertreter und der braungebrannte Bürgermeister – von denen die Dorfbewohner eigentlich wissen, dass sie nicht mit rechten Dingen zu ihrem Reichtum gekommen sein können.
Dabei spielt ein in Untergestäng beliebtes Kultur- und Sammelgut namens Gestänge eine Rolle, das auch gern gestohlen und auf dem Flohmarkt unter der Hand weiterverkauft wird. Selbst international, womit man dann fast schon am Ende der irre walzenden Geschichte auch noch die im Titel erwähnte „fremde Ausländerin“ kennenlernt, die hinter einigen der dubiosen Vorgänge zu stecken scheint, auch wenn man bis zum Schluss nicht erfährt, wer nun eigentlich wen umgebracht hat.
Zwischenzeitlich hat der so gründlich von sich eingenommene Oberhauptkommissar nicht nur den alten Gasthof aus lauter Unaufmerksamkeit abgefackelt, sondern auch die Polizeiwache samt Gemeindeamt. Nur sind die Bauleute in der Gegend von Untergestäng noch fixer als anderswo: Beide Gebäude entstehen quasi über Nacht in viel größerer Pracht. Das kleine Urlaubsdorf mausert sich (da fühlt man sich glatt an Sachsen erinnert) im Handumdrehen zu einer touristischen Destination, die von Busladungen von Besuchern überlaufen wird.
Was dann wieder die richtige Kulisse für die Ausländerin wird, die das Dorf und die von den entfleuchten Ganoven so gründlich übers Ohr gehauenen Naiven von Untergestäng mit Wohltaten und Geld überschüttet. Klar: Sie hat einen reichen Scheich geheiratet.
Was dann schon ein bisschen nach trauter deutsch-österreichischer Gegenwart riecht, dem aufgeblasenen Feiern touristischer Destinationen und stinkreicher Investoren, all der Leute, die ihre seltsamen Fernsehrollen genauso aalglatt spielen wie die Provinz-Promis in Heimat-Krimis. Was dann die banalen Märchen von heute sind, die in den bunten und grauen Gazetten alleweile die Titelseiten bekommen.
Lauter angeschminkte Helden, die aber, wenn man es recht bedenkt, mit dem, was einem bei Ausflügen ins verschlafene Land begegnet, so gar nichts zu tun haben. Eine Welt der studiogebräunten Masken und falschen Prinzen.
Aber manche halten das tatsächlich für ein wahres Abbild ihrer Heimat. Braunsteiner freilich nicht. Er lässt in diesem Buch seine Lust und seinen Frust aus an diesen heimeligen Vorstellungen von Hiesigkeit, die sich in Hiesigkeit geradezu badet, obwohl man eigentlich auch nur fleißig mauschelt und andere über den Löffel balbiert, wenn man die Gelegenheit (oder das Amt) dazu bekommt.
Diesmal mit einem kurzatmigen und etwas überlastigen Oberhauptkommissar mittendrin, der eher bemüht ist, das Wohlgefallen der Untergestängler zu bekommen, als sich diesem elenden Kleinkram ernsthafter Ermittlungen zu widmen. So werden Leute zu Legenden, indem sie einfach die erwartete Rolle spielen. Was übrigens unter Mannsbildern leichter ist, weil Mannsbilder einander permanent versuchen mit ihrer Grunzfähigkeit zu beeindrucken. Das ersetzt die halbe Arbeit und bringt die Leute zum Staunen oder Kopfeinziehen. Je nachdem.
Auch in dieser Geschichte, die übrigens ohne die Ausländerin am Ende ausgegangen wäre mit einer völlig ungelösten Mordserie in einem Dorf, in dem man sich auch ohne fremden Besuch nur zu gern der Illusion hingab, dass Honoratioren ehrenwerte Leute sind und ihr protzig ausgestellter Reichtum mit Fleiß zusammengetragen wurde, es also auch nur Seppln sind wie unsereiner, nur halt ein bisschen braungebrannter und ehrenwerter.
Ihnen kommen natürlich gemütliche Polizeier, die auch erst morgen vorbeischauen, wenn der Überbeschäftigte vielleicht mal Zeit hat für ein Gespräch wie gerufen. Wer wird es sich als braver Polizist schon mit der Obrigkeit verscherzen, wenn es um ein paar geklaute Gestänge und ein paar tote Dorfbewohner geht? Eine verärgerte Obrigkeit ist ja viel schlimmer. Gar heute, wo wir doch gar keine mehr haben.
Paul Braunsteiner „Die fremde Ausländerin“, Einbuch Buch und Literaturverlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro.
Morteratsch: Zwei Tote, ein Gletscher und die Pfeife von Maigret
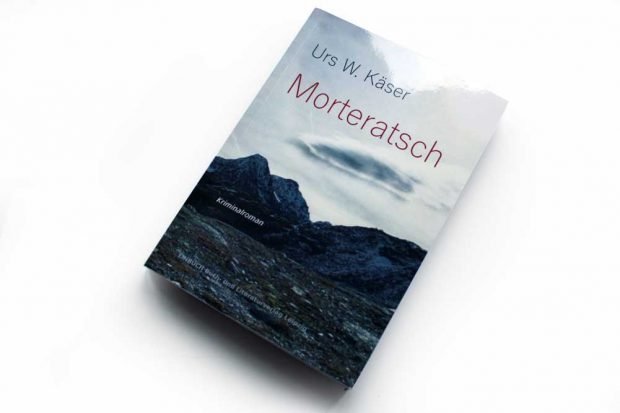
Urs W. Käser: Morteratsch. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserEs ist nicht sein erster Krimi, den Urs W. Käser jetzt im Leipziger Einbuch Verlag vorgelegt hat. Mit „Hoffmanns Tode“, „Mosers Ende“ und „Gornerschlucht“ hat der 1955 geborene Schweizer Autor schon drei Kriminalromane aus der Schweizer Bergwelt veröffentlicht. In seinem vierten Krimi geht es nach Pontresina, einem Dorf unterhalb des Piz Morteratsch. Und dessen Gletscher spielt in diesem Krimi eine nicht unwesentliche Rolle.
Denn der Morteratschgletscher gibt nach 33 Jahren die Leiche eines Verunglückten frei. Und auf einmal geht das große Rätselraten wieder los: Was ist damals passiert? Hat da jemand einfach seinen Konkurrenten um die Liebe der Dorfschönen Seraina beiseitegeschafft? Und dann gar bei der Suchaktion verhindert, dass an der richtigen Stelle gesucht wurde?
Damals konnte ihm das nicht nachgewiesen werden. Nun auf einmal aber deuten alle Indizien darauf hin, dass der Mann vielleicht doch die Last eines Toten auf sein Gewissen geladen hat. Da bekommen also die beiden Pontresiner Polizisten Claudia Costa und ihr Chef Curdin Morell alle Hände voll zu tun, gibt es neue Untersuchungen auch am Gletscher und ein junger Geologe bringt die Gefühle der Polizistin Claudia heftig durcheinander.
Doch noch während die Beteiligten irgendwie zu verdauen versuchen, dass der alte Fall nun wieder aktuell ist und damit alte Beziehungsdramen aktuell werden, platzt ein neuer Todesfall ins friedliche Leben des Urlaubsortes. Ein Fall, der nun auch noch Kriminalkommissar Silvio Fontana nach Pontresina bringt, der jetzt mit recht eigenwilligen Methoden versucht, den Täter (oder die Täterin) zu erwischen.
Mit seiner tabaklosen Pfeife im Mundwinkel versucht der Mann gar, sich ein wenig den Habitus des legendären Kommissar Maigret zuzulegen. Und zuweilen geht er auch ein wenig so vor, nennt es auch Bauchgefühl, obwohl ihm diesmal durchaus moderne Untersuchungsmethoden bis hin zum genetischen Spurenabgleich zur Verfügung stehen. Letzterer bringt dann auch endlich den belastbaren Fingerzeig auf den tatsächlichen Täter, nachdem vorher zahlreiche Verdächtige im Fokus waren.
Nur dass die Verdächtigen in diesem wohlhabenden Örtchen nicht wirklich viel mit den Gestalten in den Maigret-Romanen zu tun haben. Ganz so, als wäre das alte Grundthema Simenons verschwunden. Was es nicht ist. Aber das bemerken ja selbst die Kommentatoren der großen Zeitungen nicht mehr. Wie zwangsläufig die Helden und Heldinnen bei Simenon in der Täterfalle sitzen, erschließt sich ja oft erst, wenn der seinen Kommissar Maigret am Ende der Ermittlungen auch noch die Motive der Ertappten aufdröseln lässt.
Denn er löst seine Fälle ja nicht mit modernen Polizeimethoden, sondern so, dass er versucht, die Täter als Getriebene zu begreifen, als Menschen in ihrer sozialen und persönlichen Not. Bei ihm sind die Täter keine finsteren Monster, sondern ganz normale Menschen, die irgendwann nicht mehr anders konnten, als sich schuldig zu machen.
So wurden die Maigret-Romane eben deutlich mehr als die üblichen Krimis, in denen sich alles nur darum dreht: Wer war’s?
Das weiß Kommissar Maigret meistens schon recht früh. Er kriecht regelrecht hinein in die Lebenswelt seiner Zeugen, geht den Ereignissen am Tattag akribisch nach, zieht sich also im Grunde das Leben der Protagonisten an wie eine zweite Haut. Und deshalb versteht er sie auch, begreift ihre Motive und sieht die Zwangsläufigkeit ihres Tuns. Was er auch deshalb kann, weil er selbst aus kleinen Verhältnissen stammt.
Jeder Maigret-Roman entführt in diese Welt der kleinen Leute. Bis ins Detail stimmt das Interieur. Und schon nach wenigen Seiten ist der Leser selbst im Sog dieser Atmosphäre, tappt mit dem wortkargen Kommissar durch ungemütliche Straßen, armselige Bars, in triste Wohnungen und in Einöden, in denen man schnell spürt, wie schwer Ausweglosigkeit auf Menschen lasten kann, die nicht viele Möglichkeiten haben, einem tristen Dasein zu entkommen.
Es ist nun einmal so: Wer als Autor mit solchen Anspielungen spielt, muss sich den Vergleich gefallen lassen. Und vielleicht sind die letztlich doch wohlhabenden und gut versorgten Bewohner von Pontresina nicht wirklich das Personal, das in einer Maigret-Geschichte spielen könnte. Und auch der Täter, der am Ende auch noch ein Geständnis schreibt, gehört nicht dazu, auch wenn sich nun zeigt, wie sehr er zeitlebens unter seinem Misserfolg bei den Frauen gelitten hat.
Ein durchaus modernes Thema, das auch seine erschreckenden Seiten hat, wenn man an die vielen Amokläufe sogenannter Incels in letzter Zeit denkt, die ihr als aufgezwungen empfundenes Zölibat mit Allmachtsphantasien zu kompensieren versuchen und dann wehrlose Menschen erschießen.
Auch diesem Thema hat sich Simenon genähert – anders freilich, als es Urs W. Käser tut. Auch diese von Beziehungen und Frauen enttäuschten Menschen versucht ja sein Kommissar Maigret zu verstehen. Auch wenn er ihnen sein Unverständnis meist sehr deutlich ins Gesicht sagt.
Denn er hat zwar viel Verständnis, wenn Menschen aus tiefster seelischer Not heraus zu Verbrechern werden. Aber er hat kein Verständnis dafür, dass Menschen sich in Infantilität verstecken und ihre Unfähigkeit, ihr Leben tatsächlich in die eigene Hand zu nehmen, damit entschuldigen, dass andere dafür verantwortlich sein sollen.
In gewisser Weise hat Käsers Geschichte die Ansätze, tatsächlich zu so einer Story im Maigret-Stil zu werden. Es gibt genug Tatverdächtige, die in diversen Beziehungsnöten stecken. Aber dazu müsste man wohl auch die brummige Art des Kommissars übernehmen, der sich von den schönen Hüllen bürgerlicher Arriviertheit nicht blenden lässt und die Ach-so-Anständigen mit skeptischem Nachfragen immer mehr in Erklärungsnot bringt.
Und Kandidaten für den absoluten Bösewicht gibt es ja genug, bis hin zum Baurat der Gemeinde, der sich sogar dafür hat bestechen lassen, dass er ein neues Baugebiet in einem von Hangrutschungen bedrohten Gebiet hat aufziehen lassen.
Doch der war’s nicht. Es ist fast ein bisschen wie bei Agatha Christie: Just der, den man nicht mal im Verdacht hatte, war’s.
Was für einen Maigret auch wieder ein Thema gewesen wäre: Wie kann einer so leben und seine Gefühle ein Leben lang in sich einsperren, ohne einmal zu explodieren?
Das verrät das Geständnis dann leider auch nicht. Was schade ist. Unsere oberflächliche Fernseh-Scheinwelt hat es eigentlich längst nötig, wieder von einem wie Maigret gründlich demontiert zu werden.
Urs W. Käser „Morteratsch“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2019, 14,40 Euro.
Der kleine Prinz, der kauzige Herr Richter und die fatale Wirkung von zu viel Geld
Fick dich Plagwitz: Die seltsame Sex-and-go-Liebesgeschichte von Pierre und Marie

James Cook: Fick dich Plagwitz. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserMit dem Titel war auch irgendwie der Verleger nicht ganz glücklich. Und mit einigen Stellen im Buch auch nicht. Eigentlich hätte er sich mehr von diesem Plagwitz gewünscht im Buch, mehr von dieser illusionslosen Betrachtung eines Leipziger Ortsteils, der sich in den letzten zehn Jahren erschreckend verwandelt hat, etwas, das einem manchmal so ein derbes „Fuck you“ auf die Lippen bringt. Weniger das, was Marie und Pierre in diesem Buch treiben.
Also mehr Stoff in der pflastermüden Tradition des Stadtteilerforschers Michael Schweßinger, weniger von solchen Szenen, die man eher in Stapelware wie „Fifty shades of grey“ vermutet. Sagt man sich auch als Leser so, bis man merkt, was dieser Pierre da eigentlich anstellt mit der Frau, mit der er gerade in einer schönen Dachwohnung in der Alten Salzstraße zusammengezogen ist. Beide kommen aus eher westlichen Gefilden. Pierre ist Arzt und schiebt 48-Stunden-Schichten im Krankenhaus, verdient aber sichtlich gut. Und Marie ist beim MDR und muss auch ganz gut verdienen. Sonst könnten sie sich die Wohnung in Plagwitz gar nicht mehr leisten.
Einkommen verschiebt die Wahrnehmung. James Cook ist zwar ein Pseudonym und der Autor hält sich heftig zurück, seine Identität preiszugeben. Aber dass er irgendwie an diesem Plagwitz hängt und dort wohl auch schon länger wohnt und sich eher zu den Ureinwohnern zählt, das merkt man schon. Er betrachtet die Veränderungen, die auch in Plagwitz zur Gentrifizierung und Hipsterisierung geführt haben, mit wachem und skeptischem Blick.
Seine kleinen Exkurse zur Veränderung der Einwohnerschaft stellen im Grunde dieselben Fragen, die auch seine Pierre-und-Marie-Beziehungskiste stellt, wenn auch elementarer. Denn diese Ureinwohner haben meist zwei, drei Jobs, um sich die steigenden Mieten noch leisten zu können und nicht „vertrieben“ zu werden, wie Cook es nennt. Und sie können sich den Besuch in einer der schnieken Locations, die von den Neuen frequentiert werden, nur selten leisten, kaufen sich ihr Bier im Supermarkt und trinken es allein für sich zu Hause.
Sie bekommen weder die gut bezahlten Jobs noch die teuren Wohnungen. Manche stranden dann bei den Gesellen, die irgendwie versuchen auf dem Jahrtausendfeld ein bisschen Gesellschaft zu finden. Oder sie verschwinden ganz aus der Stadt wie der seltsame Herr Richter, der so eine Art örtliche Legende war, weil er in sozialistischen Zeiten die Arbeit verweigerte und in modernen Zeiten dem rasenden OBM vor die Kühlerhaube sprang, im Krankenhaus landete und dort möglicherweise die Liebe seines Lebens fand, der er Berge von philosophischen Briefen schrieb.
Marie versucht diesen Richter zu finden, treibt ihn in einem Nest bei Altenburg auf, trinkt mit ihm Milch und lässt sich die Briefe vorlesen. Eigentlich plante sie wohl eine Reportage über diesen seltsamen Mann. Wochenlang werkelt sie an der Geschichte. Erst spät merkt sie, dass hinter der Geschichte eigentlich keine Geschichte steckt. Außer, dass Herr Richter in seiner ländlichen Einfalt wohl glücklich ist.
Was die junge Reporterin schon ein bisschen nachdenklich macht. Denn augenscheinlich ist das ein Widerspruch zu ihrem eigenen Leben, das sich zumeist in einer leeren Wohnung abspielt, denn Pierre ist ja tagelang nicht da. Und wenn er dann kommt, war er vorher schon gern mal im Puff. Oder er hat sich was ausgedacht für seine Marie, die er mit kunstvoll arrangierten Sex-Erlebnissen glücklich machen will.
Das sind die Shades-of-Szenen, in denen man Marie zwar teilweise recht animiert, aber doch eher skeptisch erlebt. Es ist dieses Spiel mit dem Sex, von dem unsere Gesellschaft bis über die Ohren voll ist: Selbst die früher mal seriösen Medien überschlagen sich ja jeden Tag mit neuen Geschichten über Sexpraktiken, Lustgefühle, weiche und harte Formen von Pornographie, in denen es zumeist um Spitzenleistungen, Grenzüberschreitungen und allerlei Hilfsmittel geht, mit denen noch mehr Lust erzeugt werden kann und noch mehr.
Nur das nicht, was Marie zunehmend fehlt. Denn Pierre spricht nicht wirklich mit ihr über ihr Liebesleben. Er betrachtet es augenscheinlich als eine Organisationsaufgabe, Marie ein tolles Liebesleben zu bereiten. Und während er quasi ein Lust-Event nach dem anderen regelrecht pedantisch organisiert, merkt er zwar ab und zu, dass das Marie doch nicht so richtig gefällt, auch wenn sie sich gegen die erotische Nötigung nicht wehren kann. Aber er ist so in seiner Macher-Rolle gefangen, dass er nicht einmal merkt, wie abweisend und ignorant er Marie im Alltag begegnet. Die Gefühle fallen auseinander, genau so, wie wir das in unseren Medien auch erleben. Liebe ist zum (käuflichen) Sex geworden, Partnerschaft muss organisiert werden. Nur der Sinn für das Gemeinsame geht flöten. Logisch, dass Marie zunehmend das Gefühl hat, für Pierre nur ein Objekt zu sein, ein Ausstattungsgegenstand in seinem Leben, der irgendwie mit richtigem Sex versorgt werden muss. Und dazu braucht man nur Geld. Das Pierre ja hat.
Die Möglichkeit, sich mit Geld alles kaufen zu können, richtet augenscheinlich nicht nur im hippen Plagwitz Schreckliches an und macht den Ortsteil zu einer Welt irgendwelcher schicken Locations, während die nicht so hippen Bewohner in der Unsichtbarkeit verschwinden. Und während Pierre sein Geld benutzt, um seiner Marie lauter Sex-Erlebnisse zu organisieren, begegnet diese mit dem kauzigen Herrn Richter einem Mann, der mit Vergnügen den „Kleinen Prinzen“ liest und sich über die seltsamen Typen, denen der Prinz begegnet, schwerwiegende Gedanken macht, die er in Briefen niederschreibt.
Die Gegenwelt zu Pierres Vorstellungen vom richtigen Leben wird dann über etliche Seiten die Welt des kleinen Prinzen kreuzen, in dem sich dieser Herr Richter selbst als kleiner Junge zu erkennen glaubt – mit allen Verwirrungen gegenüber all den komischen Typen vom König über den Laternenanzünder bis zum reuigen Trinker.
Es bahnt sich zwar nichts Schlimmes an – Marie kehrt auch jedes Mal heil aus dem Dorf bei Altenburg zurück. Aber ihre Reportage kommt nicht zustande. Dafür so ein wirklich schräges Gespräch mit Pierre, in dem er ihr das nächste Sex-Erlebnis geradezu aufnötigt, sich aber nicht die Bohne für ihre Reportage interessiert. Da überrascht es dann nicht, dass diese Partnerschaft nicht alt wird und Marie diesem Superperfektionisten geradezu entschwebt.
Nur dass Pierre dann binnen weniger Wochen bei den hauslosen Gesellen auf dem Jahrtausendfeld landet, verblüfft zumindest. Es erzählt aber auch von der Ratlosigkeit, die hinter all seinen Versuchen steckt, die elementarsten Dinge mit Geld lösen zu wollen. Echte Nähe gewinnt man so nun einmal nicht, Vertrauen schon gar nicht. Aber irgendetwas findet Pierre wohl bei den abgerissenen Gestalten am Lagerfeuer.
Was immerhin eine utopische Lösung für eine fatale Geschichte ist. Denn in der Plagwitzer Wirklichkeit würde sich so ein Pierre wahrscheinlich eine neue Marie besorgen, die wieder alles mit sich machen lässt und nicht lange nachdenkt über Leute, die wie in der Geschichte vom „Kleinen Prinzen“ – unglücklich hin und her fahren in schnellen Zügen und nirgendwo glücklich sind, keinen kleinen Asteroiden finden, auf dem sie einfach zufrieden sind, wenn ihre Rose eine neue Blüte bekommt. Aber es sind diese unglücklichen Unzufriedenen, die unsere Welt besetzen und die Regeln vorgeben. Auch in Plagwitz. Da stimmt dann der Titel irgendwie.
James Cook „Fick dich Plagwitz“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2018, 11,90 Euro.
Die Welt verbessern, aber wie?
Wat denkste, Karfunkel? Willy Weglehners augenzwinkernder Roman über einen alten 68er

Willy Weglehner: ’68. Wat denkste, Karfunkel? Foto: Ralf Julke
Für alle LeserIm vergangenen Jahr gab’s ja nicht nur die deutsche Revolution von 1918 als Jubiläum, auch das berühmte Jahr 1968 wurde da und dort gewürdigt. Oft mit zitronensaurem Ausdruck in den Kommentaren. Mancher will „68“ gar gleich wieder zu Grabe tragen, das Jahr ausradieren aus der bundesdeutschen Geschichte. Aber was kommt dabei heraus, wenn ein alter ‘68er sich erinnert und das Gefühl hat, er hätte eigentlich noch etwas einzulösen?
So wie dieser Ewald Karsunke, den Willy Weglehner zum Helden seines neuen Buches gemacht hat, 1967 Student in Berlin und mittendrin in den Tumulten, angefangen mit der Demonstration gegen den persischen Schah, mit der eigentlich alles begann in Westberlin. Fliegende Steine, Wasserwerfer, eine brutal agierende Polizei, der Mord an Benno Ohnesorg und Karsunkes seltsame Karriere in linken Splittergruppen, wo ihn am Ende das schäumende Sektierertum geradezu abschreckte, während draußen die Foto-Zeitung, wie sie Weglehner nennt in seinem Buch, die Stimmung anheizt, Rudi Dutschke niedergeschossen wird und Karsunke mit seiner Freundin Olga lieber nach Paris geht, um dort weiterzustudieren – und mitten in die Pariser Unruhen gerät.
Dass er sich Karfunkel nennt, hat mit seiner Liebe zur Musik der amerikanischen Flowerpower-Bewegung zu tun. Mit seinem Freund Wex zusammen singt er die Lieder von Simon & Garfunkel auf den Straßen.
Was ist er eigentlich? Ein Revoluzzer? Ein Beatnik? Ein Träumer?
Augenscheinlich nichts von allem. Denn wir begegnen ihm im Frühruhestand. Er ist ein zufriedener alter Mann, noch immer rüstig, aber froh, aus dem Berliner Verwaltungsgeschäft, wo er als Stadtplaner tätig war, ausgestiegen zu sein, denn nach der „Wende“ wurde auch der Berliner Verwaltungsapparat mit lauter Leuten aus dem Westen, der alten Bundesrepublik, geschwemmt, die nun ihre Ideen durchdrückten und ihre Art Stadtplanung. Nur kurz berührt Karsunke diese Stelle, aber man merkt: Er verabscheut Leute, die einen gängeln und bevormunden. Der Rebell steckt noch in ihm.
Und eigentlich weiß er auch, wie verführbar dieser Rebell ist, sonst hätte er 1968 auch nicht so vieles mit sich machen lassen, sich von seinem alten Schulkumpel Rodjahn nicht zum Mitmachen in seltsamen Splittergruppen überreden lassen. Wissend, dass Rodjahn schon in der Schule ein Aufschneider war, einer, der die Kunst beherrscht, anderen Leute ein schlechtes Gewissen zu machen und in ihnen das Gefühl von Feigheit auszulösen, wenn sie nicht wie er begreifen, was man tun sollte, um die „Macht des Kapitals“ zu brechen oder „den amerikanischen Imperialismus“ zu bekämpfen oder die „Arbeiterklasse zur revolutionären Tat“ anzuspornen und was der ideologischen Versatzstücke mehr sind.
Karsunke will es ja alles wissen, liest sich in Marx fest, kauft sich eine ganze Bibliothek von Lehrtexten und maoistischen, trotzkistischen und sonstwas für Schriften. So ein wenig auch zur Verzweiflung von Olga, die in ihm durchaus die Begeisterung liebt, ihn aber – anders als diesen Rodjahn – für einen Burschen hält, der bis zu Ende denkt und mit den Füßen auf dem Boden bleibt.
Sie selbst denkt ja ähnlich. Und wird am Ende Lehrerin, weil sie hier am ehesten die Möglichkeit sieht, etwa zu verändern. Als Ingenieur schlägt ja auch Karsunke eine Karriere ein, bei der er zumindest hofft, städtebaulich etwas zum Besseren zu verändern. Der „lange Weg durch die Instanzen“ ist nicht ihr Ding, auch wenn die Erinnerung an Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke wachbleibt. Und auch der Sound der Sixties ließ Karsunke nie los, sodass er sich jetzt wieder mit seinem alten Freund Wex zusammentut, um mit ihm gemeinsam die großen Songs dieser von Zuversicht geprägten Zeit zu spielen. Und das macht beiden so viel Spaß, dass sie dann kurzerhand beschließen, mit ihrem Programm wieder auf den Ku’damm zu gehen.
Und wo Karfunkel eben noch dachte, kein Mensch würde sich mehr für all diese Lieder eines unvergleichlichen Sommers interessieren, merken sie bald, dass sie die Passanten damit begeistern. Und mit dem Mädchen Flower bekommen sie gar noch eine Mitstreiterin, eine, die ihnen bald klarmacht, dass von diesem 1968 doch noch eine Menge mehr lebendig ist, als sie selbst glaubten. Mitsamt dem Unbehagen an einem Staat, der die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklaffen lässt, und der Wut auf die Nazis, die 1968 noch da waren, fein eingebettet in eine Gesellschaft, die lieber „nicht darüber redete“. Und die den drei Musizierenden nun auch 40 Jahre später wieder Ärger machen. Es hat sich augenscheinlich nichts geändert, auch nicht an der Wut der Ewiggestrigen auf den Sound einer friedlichen und offenen Welt.
Was dann Karfunkel gleich zwei Mal auch körperlich zu spüren bekommt, was aber nicht der Grund ist dafür, dass er in seinem Alter nun auch noch zwei große Narreteien beginnt. Die eine lässt ihn regelrecht die Ehe mit seiner Olga in Gefahr bringen und man erlebt den Mann auf einmal in der ganzen verblödenden Verwirrung der Hormone, wie sie eigentlich eher jüngeren Männern passiert, die – tatsächlich kopflos – alles riskieren, was sie sich mit Vernunft aufgebaut haben. Eine Affäre, wie sie tausende schrecklicher Liebesschmöker füllt, stets bestens verkäuflich, weil augenscheinlich viele Leser/-innen davon überzeugt sind, dass genau so ein Hormonrausch die große Liebe ist.
Da ist nicht nur Flower entsetzt, die Karfunkel doch eigentlich für einen vernünftigen Mann gehalten hat.
Misstraut den Hormonen, kann man da nur sagen.
Und die andere Narretei bringt Karfunkel alias Robin Grunewood tatsächlich ins Gefängnis, wenn auch nur in Untersuchungshaft, denn er wurde als jener emsige Briefschreiber ertappt, der die Foto-Zeitung und den Berliner Senat mit immer neuen Drohbriefen beschickte, in denen er schlimme Taten ankündigte, wenn nicht alsbald alle Nazis verhaftet und die Armen gespeist werden. Fetter Stoff für die Foto-Zeitung, mächtig Ärger für den Innensenator und Beginn einer riesigen Polizeifahndung, an deren Ende sich Vater und Sohnemann gegenüberstehen, der alt gewordene ‘68er und sein ach so nüchterner Sohn als leitender Kriminalbeamter, der unter dem Vornamen Ernesto noch immer leidet. So wie auch Karfunkels Tochter Rosa unter dem ihren.
Und da wir auch ein paar ganz und gar nicht traute Familienszenen erleben, weiß man als Leser an der Stelle auch schon, wie unausgeglichen und verkrampft diese Kindergeneration geworden ist. Obwohl das wohl nicht an der antiautoritären Erziehung lag, wie Karfunkel-Karsunke vermutet.
Man merkt aber auch, dass auch Williy Weglehner all diese Erinnerungen und Gedanken beschäftigen. 1948 geboren, war er im Grunde vom Alter her mittendrin in diesem 1968. Und sein Lebensweg bis zum Beginn seiner Zeit als Autor ist ein Weg der Suche nach einem Beruf, mit dem er den biederen Engen und Zwängen der bürgerlichen Erwartungen zu entkommen versuchte. Und mit zwei Büchern bei Einbuch hat er ja schon gezeigt, dass ihm dieses seltsame Konstrukt, aus dem das westdeutsche bürgerliche Lebensgefühl besteht, nur zu bekannt ist.
Er rennt ja auch in diesem Buch dagegen an mit seinem Karfunkel, der mit knapp 60 noch einmal entdeckt, dass die Träume der Jugend eigentlich noch immer lebendig sind in ihm, genauso wie die Fähigkeit zum Mitfühlen und Wütendsein. Nur dass ihm die Wandlungen des geheimniskrämerischen Rodjahn zutiefst suspekt sind. Da ist ihm die Rolle des einsamen Robin Hood irgendwie lieber, auch wenn er eigentlich ahnt, dass er damit eher zum Kohlhaas wird, auch wenn ihn selbst seine Stammtischfreude bewundern, oder vielmehr diesen Robin Grunewood bewundern, der auf eigene Faust versucht, Dinge zu ändern, von denen man am Ende nicht wirklich weiß, ob sie zu ändern sind.
Denn eigentlich weiß er ja aus seiner Zeit im Verwaltungsapparat, wie schwerfällig solche Strukturen sind, wie sehr dazu ausgelegt, Veränderungen zu verhindern. Im Grunde begegnet er denselben Phänomenen wie einst die 1968er und bekommt so eine Ahnung, dass es wohl doch sehr viele kleine Schritte sind, die die Welt verändern. Und dass man vielleicht doch am Besten bei sich selbst anfängt. Oder doch nicht? Ist seine Wiederkehr in seinen Garten, das „Kleinödchen“, nicht gar die völlige Verkehrung in die kleine Idylle des braven Bürgers, der sein Glück daheim findet und sich nicht mehr engagiert? Ist das die Botschaft der alten 1968er? Die zwar noch das Zeug zum Wutbürger haben, aber ansonsten froh sind, von der Stammtischrunde bewundert zu werden?
In gewisser Weise ist es auch ein kleiner flotter Narrenroman geworden, in dem der Held meistens auch noch weiß, dass er sich ganz schrecklich zum Narren macht. Und auch um seine Verführbarkeit, und das auch noch mit beinah 60, wo doch andere Leute meistens so tun, als wenn sie schon abgeklärt genug sind und ihnen keiner mehr etwas vormachen kann. Aber augenscheinlich stimmt das nicht. Zumindest Willy Weglehner weiß das und hält mit dem Buch auch seinen Altersgenossen ein wenig den Spiegel vor.
Diesen braven Alten, die im Garten beim Bierchen an ihre tollkühnen Zeiten zurückdenken und das Erlebte für Erfahrung halten. Um dann halt heutigen Verführungen nur allzu schnell auf den Leim zu gehen. Denn ganz so sonderbar kommt einem der späte Frühling Ewald Karsunkes gar nicht vor, wenn man es recht bedenkt. Wir glauben nur, dass das Alter weise macht, dass wir die Verwirrungen der Jugend hinter uns lassen und dann ganz vernünftige Menschen werden und unsere ganzen Eitelkeiten (genau das, über das wir verführbar sind) hinter uns gelassen haben.
Olga sagt zwar nichts dazu, auch wenn sie wohl ahnt, was für Streiche ihr Lebensgefährte da in aller Heimlichkeit plant. Aber mit Flower steckt so ein junger, fordernder Ton im Buch, so ein Widerhaken, der uns daran erinnert, dass man wahrscheinlich sehr vernünftig und offenen Herzens sein muss, wenn man die Gesellschaft wirklich verbessern will und alte Narren davor retten, sich endgültig zum Gespött der Welt zu machen.
Willy Weglehner ’68. Wat denkste, Karfunkel?, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2019, 14,40 Euro.
Ein erstaunlich zynischer Einblick in die Gefühlswelt unserer heutigen Führungskräfte
Ein Manager im Himmel: Saladins viele Versuche, endlich den Frieden mit sich selbst zu finden

Peter Beeler-Scheidegger: Ein Manager im Himmel. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserManager kommen nicht in den Himmel. Und ihr Humor ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Der Schweizer Peter Beeler-Scheidegger war selbst „Jahrzehnte lang im Topmanagement“ tätig. Er kennt also die Kollegen, die Welt, in der sie leben, und ihre Denkweise. Und er hat so eine Ahnung, was dieses Denken in der Welt anrichtet. Und mit den Menschen. Sind Manager noch zu retten? Wenigstens einer? Ein gewisser Saladin, der tatsächlich im Himmel landet?
Oder vielmehr: Den der Autor dort landen lässt, etwas verwirrt, weil Manager mit so viel unproduktiver Untätigkeit nichts anfangen können. Denn wenn man es recht bedenkt, landen im Himmel genau die Leute, die von knallharten Managern am liebsten gefeuert, fertiggemacht und ausgebeutet werden. All jene, die sich nach 30, 40, 50 Jahren Schinderei danach sehnen, endlich in Ruhe gelassen zu werden, nicht mehr funktionieren zu müssen wie ein Hamster im Laufrad.
Und weil Saladin nie gelernt hat, einfach mal loszulassen, schlägt er jetzt Gott und Petrus vor, im Himmel mal ein bisschen aufzuräumen, den Himmel quasi wettbewerbsfähiger zu machen. Nur geht das halt mit dem vorhandenen Personal nicht. Weder die Seelen der Verstorbenen noch die Engel haben die mindeste Lust, dem Mann in seiner Optimierungs- und Sanierungswut zu helfen.
Weshalb er sich nach Verbündeten umschaut, wo seine Berufskollegen alle gelandet sind: beim Teufel. Der natürlich nur zu bereit ist, mit Saladin ein ordentliches Geschäft zu machen. Was auch beinah zustande kommt, würden nicht Gott und Petrus dazwischenfunken. So war das nicht gedacht, als sie Saladin die Organisationsgeschäfte im Himmel anvertrauten.
Aber was macht man mit dem Manne? Sie geben ihm eine Chance. Er darf noch einmal auf die Erde. Nicht nur einmal, sondern vielmals. Bis er all die Dinge gelernt hat, die einen Menschen befähigen, gut zu sein. Denn darum geht es eigentlich. Auch wenn es Beeler-Scheidegger am Ende als „himmlischen Frieden“ begreift, was seinen Saladin endlich ins Reine kommen lässt mit sich und der Welt.
Denn das merkt man bald. Und es klingt wie selbst erlebt, wenn Beeler-Scheidegger erzählt, wie Manager tatsächlich ticken – nicht nur die in der Wirtschaft. Es kommen auch einige aus der Kirche, der Politik und dem Militär vor. Und Saladin schlüpft auch in ihre Haut, um darin im Grunde dasselbe zu erleben, was er auch schon in seinem tatsächlichen Job als Manager erlebt hat: Man landet in solchen Hierarchien nicht ganz oben, wenn man ein ganzer Mensch ist, der mit sich im Reinen ist, der jene Gelassenheit hat, die Saladin erst nach seinem sechsten oder siebenten Tod so langsam findet – typischerweise in einem tibetanischen Kloster, so einem, in das auch reale Manager gern fliehen, wenn sie meinen, ihre Batterie wieder aufladen zu müssen, weil sie sich ausgebrannt fühlen. Um danach dann wieder weiterzumachen in einem Job, in dem sie wieder nur Getriebene sind.
Nein, so lustig, wie Beeler-Scheidegger es ankündigt, wird das Buch nicht. Es sei denn, Menschen in solchen Führungspositionen hätten tatsächlich so einen etwas zynischen Humor. Was man sich gut vorstellen kann. Denn eines merkt man bald: Manager sind einsam, verdammt einsam. Denn sie leben in einer Welt, in der ihnen stets jemand den Job und die tolle Bonifikation streitig macht. Von unten drücken lauter Gleichartige nach, die der festen Überzeugung sind, es genauso gut, wenn nicht gar besser zu machen.
Und die alles tun, die Arbeit des Alten in Misskredit zu bringen. Und über jedem Manager sitzen die eigentlichen Chefs – die Aufsichtsräte und Aktionäre, die die Führungsmannschaft nur nach einem bewerten: Wirft das Unternehmen Gewinne ab? Und steigen sie bittesehr? Und da sie das aller Vierteljahre erwarten, werden Manager zu Getriebenen und sind permanent auf der Suche nach Lösungen, noch mehr Geld aus der Firma zu pressen.
Die Rezepte kennen wir alle. Sie gehen so gut wie alle auf Kosten der Umwelt und der Angestellten, die als entbehrlich gelten. Oder der Gemeinschaft, die man dann gern auch noch um ehrliche Steuern bescheißt. Es wird outgesourct und verschlankt. Und so ganz beiläufig gibt Beeler-Scheidegger einen tiefen Einblick in das Seelenleben seines Managers. Denn dieser Saladin ist typisch, wahrscheinlich viel typischer, als selbst der Autor glaubt. Denn er hat verinnerlicht, wie man als Manager in hohe Positionen kommt. Und das war nicht nur ein Lernprozess. Es hat seinen Charakter geformt.
Er hat all die Managersprüche verinnerlicht, die man alle schon mal irgendwo gehört hat, aber nicht unbedingt mit Managerkursen und Karriereseminaren in Verbindung bringt. Diese hier zum Beispiel: „Die Großen fressen die Kleinen, die Schnellen die Langsamen.“ Oder: „Wir müssen uns auf das Kerngeschäft konzentrieren.“ Oder „Abläufe verkürzen, Auswahlverfahren vereinfachen, Synergien bündeln“, wie es der Teufel vorschlägt. Manager grübeln nicht, Manager machen. Und wenn sie die ganze zweite Führungsebene entlassen, „um neuen Schwung in den Laden zu bringen“.
Saladins Aufenthalte auf der Erde werden regelrecht zu einem Chrashkurs in Selbsterkenntnis. Denn gelernt hat er vor allem eins: Chefs zeigen keine Schwäche, sie müssen immer und überall den Macher zeigen, eine glänzende Performance hinlegen. Sie lernen vor allem, hart zu sich selbst zu sein und auch beim Survival-Kurs über ihre Grenzen zu gehen.
Das kennt man irgendwie. Das kommt einem sehr vertraut vor. Das sind die Typen, die in unserer Gesellschaft den Ton angeben und jenes Klima erzeugen, in dem „Minderleister“ verachtet werden und selbst die kleinsten Angestellten lernen, dass sie bei aller Schikane stets zu lächeln haben. Es entsteht ein Klima, in dem der Manager ständig in Angst lebt, seinen Job loszuwerden, weil er nicht genug leistet, weil ihm nichts mehr einfällt, den Laden aufzumischen, weil der Aufsichtsrat das Gefühl haben könnte, er könnte zu weich geworden sein, nicht mehr gut genug „performen“.
Und so eilt auch Saladin Tag für Tag zur Arbeit mit dem Druck im Bauch, jetzt schnellstens wieder eine Aktion starten zu müssen, Tatkraft und Durchsetzungsvermögen zu zeigen und allen zu beweisen, was für ein knallharter Macher er ist. Wirklich zufrieden ist er nie, denn das gnädige Wohlwollen des Aufsichtsrates kann schon morgen wieder verscherzt sein. Wer liest, wie Saladin immer wieder in seine angelernten Gewohnheiten zurückfällt, der ahnt so ein wenig, warum die Manager der großen Konzerne so kopflos in immer neue Katastrophen steuern, faule Deals eingehen und auch immer weniger Risiko zulassen. Denn wer etwas Neues wagt, das nicht gleich morgen Früchte trägt, riskiert seinen Job. Dem wird „das Vertrauen“ entzogen.
Auch diese Stelle gibt es im Buch, an der Saladin (noch) zufrieden darüber nachdenkt, wie schön es ist, das Vertrauen der Aktionäre zu genießen. Nur eins hat er nicht: Urvertrauen. In der Hülle des durch großes Ego und blendendes Selbstvertrauen schillernden Machers steckt ein Mensch, der weder seinen Mitarbeitern noch der Welt vertraut. Und sich selbst auch nicht. Die knallharten Sprüche sind Durchhalteparolen. Deswegen ähneln militärische Karrieristen so auffällig Wirtschaftskarrieristen und politischen Karrieristen, die alle von der blendenden Show des Kerls leben, der „ohne Rücksicht auf Verluste“ regiert und agiert. Machertypen. Führerfiguren.
Und die dafür auch jede Menge Aufmerksamkeit von willfährigen Medien bekommen. Oder sollte man nicht lieber schreiben: opportunistischen Medien? Denn so nach dem dritten oder vierten Tod beginnt auch Saladin zu begreifen, dass er sich die ganze Zeit wie ein Opportunist verhalten hat. Er hat geliebedienert nach oben und nach unten getreten. Und er weiß, dass es alle seine anderen Mitkarrieristen genauso gemacht haben. Und genauso machen. Denn keiner von ihnen ist sein eigener Herr. Sie kaschieren ihre Rolle des funktionierenden Angestellten nur durch große Show. Eine Show, in der ihr enges Gedankenkorsett geradezu als heilige Weisheit verkauft wird. Wirklich zum Lachen wird das Büchlein nicht, auch wenn es sich Beeler-Scheidegger wünscht. Dazu zeigt es zu viel aus dieser Welt der Männer, die auch noch Weib und Kind an den Teufel verkaufen würden, wenn es ihnen nur den kleinsten geschäftlichen Vorteil bringt.
Es ist diese fast schon zynische Analyse der Gedankenwelt der heute so typischen Manager, die das Buch auch ein wenig zum Erkenntnisbuch macht: Man lernt mit diesem Saladin, wie all die Kerle ticken, die heute in verantwortlichen Positionen sitzen und alles dafür tun, dass alles so (weiter-)läuft wie es läuft. Dass die Maschine ja nicht ins Stottern kommt oder die Menschen gar zur Besinnung kommen.
Eigentlich schickt ihn Gott immer wieder hinunter auf die Erde, damit Saladin seine Manager-Kolleg/-innen dazu bringt, von diesem rücksichtslosen Agieren abzulassen, gelassener zu werden, wieder Humor und Menschlichkeit in die Welt zu bringen. Also zu lernen, dass die Welt nicht untergeht, wenn man gelassener, nachdenklicher und rücksichtsvoller wirtschaftet.
Auch wenn die letzte Geschichte darauf hindeutet, dass es Saladin doch noch gelingt, indem er wirklich gegen jede angelernte Regel der Vermarktung verstößt und damit Riesenerfolg hat, bleibt die Skepsis. Dazu bleiben die Menschen um Saladin zu schemenhaft, werden nicht greifbar. Nur er selbst gewinnt tatsächlich die Gelassenheit, die ihm endlich den Frieden mit sich selbst bringt. Er muss sich nicht mehr rechtfertigen. Nichts mehr erklären.
Er hat sich also quasi selbst erlöst.
Auch vom „wichtigen Managerwissen“, das der Umschlagtext verspricht. Wie Unternehmensführung anders sein könnte – kooperativer zum Beispiel, solidarischer und einfühlsamer – das deutet Peter Beeler-Scheidegger bestenfalls an. Wohl auch deshalb, weil es dafür kaum positive Beispiele gibt, unter den großen Konzernen schon gar nicht. Gerade dort ist der Druck auf die Manager besonders hoch und gnadenlos.
Auch das Lösungsangebot in der letzten Geschichte stellt „Wettbewerb“ und „Erfolg“ in den Mittelpunkt, eigentlich so ähnlich, wie in den großen „Spaßkonzernen“, die sich gern als jung und kreativ verkaufen, in wirtschaftlichen Entscheidungen aber genauso rücksichtslos sind wie die „alten“ Konzerne.
Der Leser fühlt sich also keineswegs miterlöst. Und so ganz lustig ist ihm auch nicht zumute. Denn dass die knallharten Entscheider keineswegs dabei sind, sich in freundliche Saladine zu verwandeln, das ist ja nun leider unübersehbar. Eher werden sie noch bissiger und rücksichtsloser, denn sie merken ja ebenfalls, dass ihre Art des Wirtschaftens gerade unsere Lebensgrundlagen zerstört.
Während ihre Aktionäre immer weiter schöne satte Gewinne und Dividenden erwarten. Da verengt sich der Fokus, da wird Panik zum Dauerzustand. Eine Panik, die die überbezahlten Zampanos ja gerade mit all ihrer Macht in die Gesellschaften des Westens drücken. Sirenen im Nadelstreifenanzug, könnte man sagen. Nur einer ist gerettet: Saladin.
Peter Beeler-Scheidegger „Ein Manager im Himmel“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2019, 13,90 Euro.
Scheitern als weibliche Lebenserfahrung
Frauen im Kostüm: Zehn Frauen-Lebensgeschichten von Jutta Pillat, die es in sich haben

Jutta Pillat: Frauen im Kostüm. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserIn jeder Frau stecken mehrere Frauen. Schon des Überlebens halber. Denn sie leben ja in keiner anderen Welt als die Männer, die mit ihren Rollen erst recht nicht zurechtkommen. Nur dass die meisten Männer nicht mal begreifen, warum sie sich in den promoteten Bildern vom Mann-Sein nicht wohl fühlen. Frauen wissen das von ihren Rollenbildern schon etwas besser. Auch wenn das leider noch nicht heißt, dass es ihnen damit besser geht – oder ging. Die DDR war ja auch so ein Wünsch-Dir-Was-Experiment.
Und Jutta Pillat, in Leipzig geboren, kennt auch noch diese oft glorifizierte Gleichberechtigung in der DDR, die – wie so vieles – nur propagiert war, aber nicht diskutiert. Außer natürlich von schreibenden Frauen. Man denke nur an Maxie Wanders „Guten Morgen, du Schöne“ oder Brigitte Reimanns „Franziska Linkerhand“. Das Bild von der emanzipierten, selbstbewussten Frau war durchaus landläufig und wurde von den Frauen auch so gelebt. Auch wenn es in der Realität vor allem bedeutete, die Doppelbelastung von Familie und Beruf schultern zu müssen, die für viele Frauen freilich eine Dreifachbelastung war. Denn den Männern wurde im Gegenzug nicht wirklich Emanzipation abverlangt.
Was dann im Alltag und im Leben zuweilen sehr diffuse, deprimierende und frustrierende Ergebnisse zeitigte. Aber das Thema war präsent. Niemand konnte ihm wirklich ausweichen. Frauen-Zeitschriften bedienten eben nicht – wie im Westen – die unbedarfte Schöne, die sich erst durch ihre Präsentabilität einen Marktwert erschafft, sondern die selbstbewusste Frau, die sich in Mode, Haushalt und Beruf auch verwirklicht.
Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, liebe Männer, aber daran seid ihr selber schuld. Denn genau dieses Thema wurde 1990 gründlich vermachot, vergeigt und verdorben bis zur Ungenießbarkeit. Von phlegmatischen Westmännern und von opportunistischen Ostmännern. Das nahm sich dann nicht mehr viel. Ich hätte damals jedenfalls nicht gedacht, dass wir noch einmal 30 Jahre übers Heimchen am Herd diskutieren.
Aber es gibt viele Möglichkeiten, eine Deutsche Einheit zu vergeigen. Diese hier wurde weidlich genutzt.
Auch wenn Jutta Pillat kaum durchblicken lässt, dass die meisten ihrer zehn Frauen-Geschichten in der DDR handeln – man kann es nicht überlesen. Es ist allgegenwärtig, genauso wie der eindeutig ostdeutsche Stolz dieser Frauen, nicht nur mit einem eigenen Beruf auch ein eigenes Einkommen zu haben und vom Mann nicht mehr materiell abhängig zu sein, sondern auch der Stolz auf ihren Beruf selbst wird sichtbar, egal, ob es Buchhändlerin, Lehrerin oder Telefonistin ist.
Denn zum Berufstätigsein im Osten gehörte eben auch eine Bezahlung, die wirklich zum Leben reichte (wenn auch nur dem ostdeutschen Lebensniveau angemessen) und die überhaupt nicht dekretierte Hochachtung vor jeder Tätigkeit. Es gab diese Verachtung eines überheblichen Mittelstandes für die Malocher und Putzfrauen da unten nicht.
Und noch etwas kommt hinzu, ist aber nur vage am Rand von Pillats Geschichten zu spüren: Die klügeren Männer im Osten nahmen das nicht nur wahr und ließen es mit sich geschehen, sondern merkten auch, was für ein Gewinn diese selbstbewusst gewordenen Frauen für sie waren. Frauen, mit denen man sich eben nicht nur über Mode und Kinder unterhalten kann, sondern die einen auch herausforderten – auf der Arbeit, in der Wissenschaft, auch in der Politik.
Wer die Bürgerrechtsbewegung in der DDR untersucht merkt, dass sie eigentlich BürgerInnen-Bewegung heißen müsste. Überall waren Frauen mit dabei, Frauen, für die der Widerspruch eines selbstbewussten Frauenbildes zur praktizierten Pass-dich-an-Politik unübersehbar und unüberwindbar war.
ANZEIGE![]()
Nur so fürs Tagebuch: Die DDR ist nicht zuerst deshalb untergegangen, weil die Westläden voller waren als die Ostläden, sondern weil sie ihre eigenen Ansprüche an den selbstbewussten und selberdenkenden Menschen nicht bereit war zu erfüllen.
Und das webt in Pillats Geschichten mit fort, die allesamt Berufsgeschichten sind. Deshalb das Kostüm im Titel, das aber nichts mit dem Modezeitschriften-Kostüm zu tun hat, sondern – manchmal auch nur symbolisch – das Kostüm ist, das Frauen für ihre Rolle auf der Arbeit anziehen müssen. Wieder anziehen müssen. Denn es gibt auch bei Jutta Pillat die Geschichte davor und danach. Und die Geschichte danach, nach dem testosterongesteuerten deutschen Einheitsklumpatsch, war eben auch für viele ostdeutsche Frauen die Erfahrung von Rückstufung, Abwertung, Arbeitslosigkeit.
Fast über Nacht verwandelten sie sich wieder in dieselben abhängigen Puttchen aus der Zeit ihrer Großmütter, die froh sein sollten, überhaupt irgendwie als Arbeitsblümchen akzeptiert zu werden. Sie flogen zuallererst einmal aus sämtlichen Leitungspositionen, die sie im Osten wie selbstverständlich schon erobert hatten. Wenn sie sich bemühten, durften sie auch den neuen Machern fleißig helfen, neue Projekte und Unternehmungen hochzuziehen. Aber gerade die letzte Geschichte („Anfang und Ende“) erzählt auf eine beinah bedrückende Art, wie dann oft genug mit ihnen umgegangen wurde, wenn die Dinge etabliert waren und ein paar Männer mit dicken Titeln eine neue Leitungsfunktion suchten.
Oft wirken die Geschichten von Frauen im DDR-Alltag wie eine Gegenfolie zu dem, was nach der „Wende“ Frauen zugemutet – oder wohl besser: verweigert wurde und wird. Bis heute.
Das Selbstverständnis, Frauen auch mit Kindern und Familie in Leitungsfunktionen zu berufen, ist schlicht nicht da. Und das wirkt nicht zufällig bei Jutta Pillat wie ein Albtraum. Denn es ist ein Albtraum, wenn Menschen allein wegen ihres Geschlechts verweigert wird, sie gleichberechtigt zu behandeln und – wie eben in dieser letzten Geschichte – zu feige zu sein, darüber auch noch zu sprechen. Es ist dieses Verschwiemelte, Heimtückische, das nicht nur Frauen zermürbt und krank macht.
Im Ausmaß war das nach 1990 neu, in den Wurzeln nicht. Denn in der Geschichte „Die Begutachtung“ schimmert ein wenig von Jutta Pillats eigener Erfahrung als Lehrerin in DDR-Zeiten durch. Auch das eine Geschichte von verdruckster und zur Sprache unfähiger Machtausübung, die dazu führt, dass die Deutschlehrerin, die ihre Schüler begeistert, das Handtuch wirft, weil sie nicht zur Ableserin werden will, die die Kinder nur mit Phrasen langweilt. Es kommt so ein Stück Null-Bock-Geschichte durch, die uns heute aus sächsischen Schulen so oft entgegenschlägt. Das hat alles miteinander zu tun – und es hat mit Männern zu tun, die Frauen misstrauen, selbstdenkenden Frauen erst recht.
Wird es deshalb ein bissiges Buch?
Eher nicht. Die Autorin betont zwar, dass alle Personen und Unternehmen in den Geschichten erfunden sind. Aber dazu steckt zu viel erlebte Wirklichkeit darin. Wäre Jutta Pillat mit Tonbandgerät losgezogen, hätte sie einen dicken Nachfolgeband zu „Guten Morgen, du Schöne“ veröffentlichen können. Lauter Geschichten über den Selbstbetrug einer Gesellschaft, die von Emanzipation redet, aber nicht mal weiß, wie das geht. Weil dann schnell sämtliche Abwehrmechanismen in Gang kommen: Nur ja keine starke, selbstbewusste Frau im Büro, in der Beratung oder gar im Haus. Ja nicht!
Und weil das systemimmanent ist, machen alle Frauen wieder dieselben Erfahrungen, merken schnell, wie ihre Arbeit, ihre Ausbildung, ihr Einsatz entwertet werden. Helfen dürfen sie überall, Feuerwehr spielen auch. Aber wenn es um Beförderung, Anerkennung oder gar Augenhöhe geht, merken sie schnell, dass ein paar opportunistische Hosenträger das alles schon unter ihresgleichen verteilt haben und gar nicht daran denken, zu so gewöhnlichen Menschen wie Frauen herunterzusteigen.
Weshalb es in einigen Geschichten auch zu kleinen familiären Katastrophen kommt, auch in einer Geschichte, in der man zuerst denkt, dass sich hier zwei junge, selbstbewusste Künstler gefunden haben. Aber auch hier kann der männliche Teil nicht aus seiner Macho-Rolle. Und wieder muss sich frau neu erfinden. Mehrere Geschichten handeln von diesem Sich-immer-neu-Erfinden, bis zur Kontur- und Machtlosigkeit, um nur irgendwie zu einem Arbeitsmarkt zu passen, der Qualifikationen und Berufserfahrung im Handumdrehen entwertet …
Da setze ich einfach mal drei Punkte, weil auch diese Entwertung dazu geführt hat, dass für viele Menschen nichts mehr ging und eine ganze Gesellschaft in regelrechte Depression verfiel. Und das betraf zuallererst die Frauen im Osten, die als hübsche Sekretärin nur zu beliebt waren. Sie ahnten es zwar, dass das so war, und verleugneten sich regelrecht, wie es Jutta Pillat auch in einigen Geschichten beschreibt, manchmal so weit, dass sie auch ihre Seele und ihre Hoffnung verloren.
Wohl wissend, dass eine Verwirklichung im Beruf auch gesellschaftliche Anerkennung bedeutet, fast sogar eine Anerkennung als „richtiger Mensch“. Denn die Frauen, von denen Pillat erzählt, sind Frauen, die ihr Leben als etwas begreifen, das sie selbst gestalten wollen, in dem sie sich auch beruflich beweisen wollen – und das kann man in der Regel als Putze oder Gabelstaplerfahrerin nicht.
Die Geschichten kommen fast beiläufig daher, gänzlich ohne Aufregung. Man erlebt Frauen, wie sie ihr Leben anpacken, wie sie sich selbst motivieren, mehr daraus zu machen. Und wie sie dann oft genug an einen Punkt kommen, an dem ihnen nahegelegt wird, sich doch bitte schön anders zu benehmen oder zu gehen. Noch mehr als Männer erleben Frauen die allgegenwärtigen zumeist sehr eindringlichen Aufforderungen, sich doch bitte anzupassen. Nicht aus dem gesetzten Rahmen zu fallen.
Sonst …
In gewisser Weise sind diese Frauen-Lebensgeschichten ein Spiegel unserer von Patriarchen gemachten Wirklichkeit. Und genau weil das so ist, wissen Frauen mehr über uns, als wir uns so in männlicher Selbstgewissheit meist zugestehen. Sie sehen uns ja agieren. Und das ist nicht lustig. Auch nicht berauschend oder erhebend. Meistens eher schäbig, egoistisch und selbstverliebt.
Aber ich zähle jetzt die Garde unserer selbstverliebten Eigengewächse nicht auf. Sonst wird es tatsächlich deprimierend. Und man kreist um die nur zu berechtigte Frage: Ja, wo sind die Frauen in diesen Positionen? Und warum sind sie nicht da?
Ein paar Gründe findet man in Jutta Pillats Geschichten, wenn auch eher beiläufig. Denn eins haben die meisten Heldinnen dann irgendwann begriffen: Für ihr gutes Gefühl im Leben sind die Männer gar nicht so wichtig.
Braucht jetzt jemand ein Schnupftuch?
Jutta Pillat Frauen im Kostüm, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2019, 13,40 Euro.
Sie wollten schon immer wissen, wo unsere Steuergelder verschwinden?
Eine Beamtenposse mit starker Neigung zur Wirklichkeit: Die Geschäftsstelle

Willy Weglehner: Die Geschäftsstelle. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserDie Suche auf Willy Weglehners Homepage spuckt zwar zu den Namen Ilf und Petrow keinen Treffer aus. Aber Ilja Ilf und Jewgeni Petrow sind, wenn man es recht bedenkt, die eigentlichen Vorbilder für das, was Willy Weglehner in seinen Büchern anstellt. Man kann den Olymp auch um Michail Sostschenko und Nikolai Gogol erweitern. Denn eins wussten die Russen nur zu gut: Ämter und Behörden führen ein bizarres Eigenleben. Und Revisoren und Ministerialbeamten ist nicht über den Weg zu trauen.
Nicht unbedingt, weil sie keine sympathischen und fleißigen Leute wären oder ihre Arbeit nicht täten. Aber – das musste nicht erst Kafka erfinden – Behörden entwickeln ein Eigenleben und sie neigen dazu, sich zu verselbständigen. Die Vorgänge werden wichtiger als die betroffenen Menschen. Und die eigene Position auf der Titel- und Einstufungsleiter wird wichtiger als die Lösung der vorliegenden Probleme.
Deshalb sieht auch in Deutschland vieles so aus, wie es aussieht, stockt auf völlig unerklärliche Weise, scheint jeglicher Kontrolle durch gewählte Parlamente entzogen. Und wenn dann so ein Behördenleiter mal öffentlich Stellung nehmen muss, versteht er ganz offensichtlich das Problem nicht mehr oder hält es für ganz selbstverständlich, dass Dinge unerledigt blieben oder mit einem behördlichen Befund abgewimmelt wurden, den man mit dem alltäglichen Sachverstand eines nicht verbeamteten Fußgängers nicht mehr verstehen kann.
Und das passiert nicht nur auf Bundes- oder Landesebene. Selbst im Lokalen macht man diese fast mystischen Erfahrungen und bekommt immer wieder das drängende Gefühl, dass sich Verwaltungshandeln auf sehr deprimierende Weise verselbständigt hat. Und das ist auch nicht nur in Sachsen so. Willy Weglehner scheint seine eigenen mystischen Erfahrungen mit solchen Beamten im schönen Franken gemacht zu haben.
In Sachsen haben wir zwar eher das baden-württembergische Beamtenmodell übernommen, aber warum soll es den Bayern besser gehen? Auch sie erleben mit, wie ungreifbare Behörden Planungen für Großprojekte durchziehen, gegen die die betroffenen Bevölkerungsteile vergeblich protestieren. Auch sie erleben mit, wie die seltsamen Geschäfte dubioser Investoren mehr Einfluss auf die Entscheidungen im Ort nehmen als die Beschlüsse des eigenen Gemeinderats.
Und sie werden sich genauso oft fühlen wie Laurence J. Peter, der ja bekanntlich das berühmte Peter-Prinzip beschrieb, das möglicherweise genau beschreibt, wie mit unfähigen Amtswaltern umgegangen wird, wenn ihre Unfähigkeit nicht mehr zu übersehen ist. In der Regel werden sie nämlich nicht gefeuert oder mit fürstlicher Vergütung in den Ruhestand geschickt, sondern befördert. Erst recht, wenn sie vorher viel Einfluss hatten und möglicherweise über Insider-Wissen verfügen und sich auch noch festklammern an ihrem Posten.
So wie die vier Beamten aus vier verschiedenen Bundesländern, die Willy Weglehner in seinem Buch den eigentlich fälligen Abschied aus dem Staatsdienst überleben lässt. Eigentlich wären alle vier in jener Wonneposition, über die sich jeder Malocher im Land freuen würde – mit 58 oder 59 in Pension gehen zu können. Aber augenscheinlich haben sich alle vier so erfolgreich gegen den Ruhestand gewehrt, dass sich ihre Vorgesetzten nur noch dadurch zu helfen wussten, dass sie die vier in eine völlig neu geschaffene Geschäftsstelle im Innenministerium abschoben, also quasi ausparkten.
Was schon ein herrlicher Kniff ist. Man ahnt schon Monty-Pythonsche Auftritte, kämpfende Ritter der blanken Amtsgewalt. Aber es wird noch besser. Denn die vier können wirklich nicht loslassen. Und: Sie kennen die deutschen Behörden nur zu gut. Sie wissen, wie man sich als Staatsbediensteter Projekte macht und sie durchzieht mit allen Finessen.
Und da sich die Leute, die sie so in eine völlig namenlose Dienststelle abschoben, augenscheinlich keine Gedanken gemacht haben darüber, was vier im Dienst ergraute Beamte dann eigentlich anstellen, werden sie kreativ, erfinden sich eigene Aufgaben, lassen sich Stempel machen und verschaffen ihrer namenlosen Dienstelle bald einen unheimlichen Ruf. Denn was so namenlos agiert, das muss ja wichtig sein. Da funktionieren alle Schreckmomente in jeder Hierarchie. Da wird nicht nachgefragt. Es könnte ja sein … In Hierarchien regiert das Gesetz der Unterordnung. Wenn eine unbekannte Dienststelle nicht unterhalb der eigenen Verantwortlichkeit auszumachen ist, muss sie ja drüber stehen.
Natürlich ist ein schönes Gedankenexperiment. Aber so ganz realitätsfern nun auch wieder nicht. Solche Kunststücke bekommen ja auch sehr wohl bekannte Ämter fertig – sie werden von Rechnungshöfen dafür gerügt, im Fernsehen dafür belästert, manchmal auch von Staatsanwälten genervt. Aber in der Regel passiert den staubgrauen Beamten, die gerade einmal wieder mehrere Millionen DM oder Euro verbrannt haben, nichts. Kann ja passieren. Sie haben sich ja trotzdem ans Regelwerk gehalten. Der Bund der Steuerzahler kann ein Lied davon singen. Er kann es aber nicht ändern.
Und was die vier ehrwürdigen Herren hier vormachen, wirkt nur zu vertraut. Man muss nur auf der richtigen Ebene die richtigen Anrufe tätigen oder Anforderungen stellen, schon fließen die Millionen, flutschen die Geschäfte und werden die Infrastrukturprojekte flugs aus dem Boden gestampft, für die gewöhnliche Gemeinderäte und arme Länderminister ein ganzes Leben brauchen.
Wir landen mit Willy Weglehner in den wilden 1990er Jahren, der Zeit, die für einige Leute auch eine echte Goldgräberzeit war. Und einige der mehr als seltsamen Förderprojekte, die die vier Herren mit herrlichen Millionen aus dem Boden stampfen, entstehen natürlich im wilden Osten.
Aber wer so mit Millionen agiert, lebt auch im Misstrauen. Das Quartett bleibt nicht lange ein vertrautes Häufchen, das Misstrauen wächst, man wird auch sichtlich etwas kriminell. Wobei das auch nicht ganz so klar ist, denn so emsig wie diese vier vertickt ja auch die Bundesrepublik Deutschland alte und neue Waffen an allerlei zahlungsbereite Leute mit schlechtem Leumund in aller Welt.
Man zweifelt nicht wirklich daran, dass so eine mysteriöse Geschäftsstelle entstehen könnte im riesigen Behördenapparat der Republik. Man ist eher geneigt, sie exemplarisch für ein paar real existierende Dienststellen zu nehmen, wo sich Unfähigkeit mit Unersetzlichkeit tarnt und die Millionen für die seltsamsten Dinge in der Landschaft verbaut werden.
Nur ist Willy Weglehner vorsichtig. Er vermeidet den Eindruck, er könne tatsächlich die eine oder andere konkrete Behörde und den einen oder anderen sehr besonderen Behördenleiter gemeint haben. Er führt extra noch einen fleißigen hessischen Trinkbruder ein, der mit dem fränkischen Teil der so gar nicht kaltgestellten Altbeamten regelmäßig beim Äbbelwoi zusammensitzt und sich erzählen lässt – quasi als trinkfreudiger Beichtvater.
Aber eigentlich ist er nur ein versoffener Autor, der in den Erzählungen seines Trinkgenossen auf einmal den Stoff für einen fetten Roman entdeckt, den er dann auch zu schreiben beginnt. Und je mehr er schreibt, umso häufiger verzichtet er auf Alkohol – und so nebenbei wird er seinem Trinkbruder unheimlich, weil er über die so geheimen Vorgänge in der so geheimen Dienststelle augenscheinlich besser Bescheid weiß als die dort Residierenden. Was dann dazu führt, dass er selbst zum Teil des Kleeblatts wird – und noch unheimlicher.
Am Ende weiß man nicht wirklich, wer aus der Runde alles überlebt hat und ob die Geschichte nicht doch nur eine sehr phantasievolle Erfindung dieses trinkfreudigen Leo sein mag. Immerhin geht der Trug sehr lange, findet das Treiben der Geschäftsstelle unerwarteten Widerhall bis nach Brüssel, wo ja auch diverse Leute ihre kleinen und großen Projekte versuchen, in Taten und Gelder umzusetzen. Sodass am Ende selbst die Einführung des Euro – als völlig schiefgelaufener Versuch einer Geldumverteilung – noch aus dem Wirken der vier übermütigen Herren entsprießt, die aus der Tatsache, dass sie nicht aufhören wollen zu walten, ihr Recht erdenken, dann eben das ganz große Rad drehen zu dürfen.
Je größer, umso besser, umso undurchschaubarer für die Kontrollinstanzen, die es möglicherweise irgendwo gibt. Die Frankfurter Presse ist es nicht, erfahren wir noch. Die emsig recherchierte Geschichte des dortigen Reporters wird von den Chefs als völlig unglaubwürdig eingeschätzt. Ganz ähnlich geht es einem emsigen Steuerprüfer.
Man wird schon sehr misstrauisch beim Lesen, weil einiges von dem Geschilderten einem doch verflixt vertraut vorkommt: Behördenleiter müssen ihr Tun nicht rechtfertigen, niemand wird für verfehlte Großprojekte zur Verantwortung gezogen, Steuermillionen versickern in ungreifbaren Quellen, aber niemand weiß, wer sie verschwinden ließ usw.
Logisch, dass man da wieder Lust bekommt, bei Gogol, Ilf und Petrow zu lesen und in ihrem von Titeln besoffenen Russland das von Ämtern und Rängen eingelullte Deutschland wiederzuerkennen. Sind unsere emsigen Würdenträger denn anders als die bei Gogol? Weniger eitel, weniger machtdurchdrungen und weniger besessen von dem Wunsch, diese Macht auch zu gebrauchen und die starren Grenzen des Amtes zu überschreiten? Wer will denn nicht strahlend im Blitzlichtgewitter stehen als großer Zampano und Gönner?
Am Ende landet Leo dann gar noch in der Klapsmühle. Der Inhalt seines Buches scheint dann doch diversen Instanzen zu brisant gewesen zu sein. Und allein ist er da natürlich auch nicht. Wer wird die heilige Redlichkeit der Ämter infrage stellen wollen, schon gar, wenn sie gar keinen Namen haben und nicht existieren, wenn mal einer versucht nachzufragen?
Oh, dieser leise Ruf von Macht und Gnädigkeit. Fast vermisst man ihn selbst, den verehrten Pawel Iwanowitsch Tschitschikow. Aber irgendwie steckt in jedem der vier so ein Tschitschikow und in Leo eher kein Tolstoi, sondern ein listiger Gogol, der weiß, dass ihm für die Veröffentlichung zumindest nicht Sibirien droht. Eher ein paar Persönlichkeitsklagen von fülligen älteren Herren, die sich porträtiert fühlen, obwohl sie gar nicht gemeint waren.
Willi Weglehner Die Geschäftsstelle, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2018, 13,90 Euro.
Ein zutiefst ironischer Ausflug mit Willi Weglehner hinter die Kulissen von Schlager, Showbiz und Volksmusik
Keine Sause ohne Brause oder Amadeus‘ atemberaubende Reise in die Welt der falschen Stars

Willi Weglehner: Keine Sause ohne Brause. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserWir sind nicht allein. Man könnte heulen vor Glück, es gibt da drüben, jenseits der innerdeutschen Kontrollgrenze, tatsächlich noch Menschen. Auch in Bayern. Solche, die sich trauen, sich einen „bis dato bekennenden 68er“ zu nennen, und das antike Bildungsideal noch für etwas Wertvolles halten. Man ahnt schon: Willi Weglehner, 1948 in Thalmässing, Mittelfranken, „gootlob nachgeboren“, ist Lehrer. Lehrer im Ruhestand. Nimmer ruhend, denn er schreibt seitdem emsig Romane voller Spaß am Träumen.
Denn was sein Held Friedhelm Haberfeld alias Amadeus Brause alias Amadeus M. hier erlebt, ist ein Traum. Einer, von dem viele träumen: Einmal nur berühmt werden mit einem tollen Song, einem ganz besonderen Sound, einmal ein Star sein.
Unsere Welt ist so. Sie macht die Menschen närrisch und treibt sie in die Hatz nach Ruhm und Geld. Nur dass es Amadeus tatsächlich passiert, der eigentlich nur ein kleiner Sachbearbeiter am Amtsgericht in Günzburg ist, der sich nebenbei als Musiker auf Volksfesten und Familienfeiern was dazuverdient. Er singt, was gewünscht wird. Auch das Kufsteinlied, wenn’s verlangt wird. Noten lesen hat er nie gelernt. Er lernt nach Gehör. Und so kommt manches etwas anders heraus, als es erwartet wird. Den Leuten gefällt es – bis auf einen, der stänkert und den armen Sänger regelrecht stalkt, bis der entnervt mit seinem Kumpel Knut nach Mallorca entflieht.
Wo die Geschichte dann erst richtig losgeht, denn Mallorca ist ja so etwas wie das 17. Bundesland, wo Millionen Deutsche versuchen Urlaub zu machen und dann doch wieder nur in sentimentaler Sehnsucht nach heimischer Volksmusik ersaufen. Was übrigens der Punkt ist, wo sich die erfundene Geschichte um Amadeus mit der realen Geschichte von Willi Weglehner kreuzt, denn der Titel „Palma di Mallorca“, den Amadeus aus allen Fenstern und Radios hört, stammt von Willi Weglehner – gesungen hat ihn Chris Wolf. Und wer den Clip dazu auf Youtube anschaut, hat das seltsame Gefühl, dass sich da augenscheinlich zwei begabte Knaben zusammengetan haben, um die deutsche Schlageritis so richtig auf den Arm zu nehmen.
Und dabei geht es auch in „Keine Sause ohne Brause“, auch wenn die Karriere des Amadeus Brause zwar in Mallorca noch einmal erstaunliche Triumphe feiert, aber dann kommt Didi dazwischen, ein landesweit bekannter Produzent, der weiß, wie man Stars und Hits am laufenden Band macht. Regelrecht macht. Man lernt nachher noch einige seiner Methoden kennen, wie man das macht. Und wie in Deutschland Hits und Verkaufserfolge organisiert werden. Denn mit guter Musik oder talentierten Musikern hat das alles nichts zu tun. Es ist längst eine eigene Medienblase, in der sich das schwere Geld mit der Eitelkeit mittelmäßiger Sängerknaben und der Gier hochbezahlter Senderangestellter trifft.
Die Ähnlichkeiten sind nicht unerwünscht, schreibt Weglehner zur Warnung. Man merkt schon, dass er all diese Typen mag wie ausgelatschte Stiefel. Denn sie sind überall. Sie verstopfen mit ihrem Gejaule alle Fernsehkanäle, röhren aus den Radios und werden gehandelt, als wären sie Beethoven oder Mozart. Und ihr Gesülze passt leider genau zum üblichen deutschen Heimatgesülze, das seit 1948 bestimmt, was zwischen Alpen und Alpen als Heimat zu gelten hat. Genau das, was im „Kufsteinlied“ zu hören ist. Und Didi findet noch mehr solcher tränendrückender Gassenhauer aus der Schlagerwundertüte der 1950er Jahre, die er für seinen neu kreierten Star Amadeus M. aufpeppen und aufpoppen lässt, bis sie irgendwie wie ein heutiger, mediterraner Party-Hit klingen.
Und Amadeus spielt mit. Vorerst, weil ihn das doch irgendwie reizt und er lange an die Zauberkünste Didis glaubt, der scheinbar Karrieren aus dem Nichts schaffen kann. Ein echter Zampano des Schlagers. Es braucht wirklich erst Nina, die Amadeus nach und nach dazu bringt, diese bunte Glitzerwelt des Showbiz nicht immerfort mit rosaroter Brille zu sehen. Sie selbst hat schon erlebt, wie schnell Didi seine Künstler fallen lässt, wenn sie ihm zu nervig werden.
Aber sie hat sich nicht abservieren lassen, sondern gelernt, wie man Verträge liest und in welchen Klauseln der Betrug steckt. Klauseln, die auch der in Strafsachen erfahrene Amadeus nicht findet, weil er sie nicht sucht. Er ist bis auf den tiefsten Grund naiv. Auf eine wohltuende Art naiv. Wenn Nina die Sache nicht in die Hand genommen hätte, wäre er einfach ausgenommen worden wie eine Weihnachtsgans, ausgenutzt und wahrscheinlich irgendwann entsorgt. Dann nämlich, wenn Didi und seine Kumpel vom Fernsehen mit ihm keine Supergewinne mehr einfahren würden.
Am Ende spielt zwar ein berühmter Privatsender die wichtigste Rolle, wenn es um die heute überall zelebrierten Talente-Shows geht, bei denen junge Leute nur allzu bereit sind, sich völlig bloßzustellen in der simplen Hoffnung, doch einmal irgendwie berühmt zu werden. Aber die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht besser. Sie funktionieren nach demselben Prinzip und die Skandale um bestechliche Redakteure, die „was drehen können“, wenn einer nur ein bisschen Geld für die Kaffeekasse beisteuert, sind so lang noch nicht her.
Aber man kann auch die ganzen Musiksendungen nehmen, die etwas bedienen, was viel mit Business und Heimatsülze zu tun hat, aber wenig mit richtig starker Musik. Dass das deutsche Fernsehen mal eine Bühne für die wirklichen Talente im Land werden würde, davon träumt nicht nur Willi Weglehner nicht mehr.
Sein Buch ist eine lustvolle, da und dort sehr ironische Abrechnung mit diesem Business und mit den selbstverliebten Leuten, die sich da als Kulturwächter der Nation gerieren. Und mit Amadeus hat er einen Burschen geschaffen, der alle Gaben mitbringt, in diesem Geschäft so regelrecht zum Clown zu werden (was er am Ende auch wird). Und zuletzt so richtig zu scheitern. Es ist auch ein Buch über die falschen Träume vom Ruhm, die dieses Show-Business die ganze Zeit verkauft, weil sich das an ein geblendetes Publikum so gut verkaufen lässt. Denn nicht nur die untalentierten Mütter der untalentierten Kinder sind wie verhext von dem Wahn, ihre Kinder müssten unbedingt „ins Fernsehen“ und dann von frenetisch klatschenden Millionen gefeiert werden.
Und irgendwie ist es ja nach 60 Jahren Show längst so, dass die meisten Leute tatsächlich daran glauben, dass das Fernsehen die Bühne der Wirklichkeit ist. Und keine Vorspiegelung falscher Tatsachen rund um die Uhr.
Amadeus hat Glück, weil Nina dieses Geschäft kennt und weiß, wie die Herren Meinungsmacher die Millionen scheffeln und Knebelverträge formulieren. Sie nimmt ihn zuweilen hart am Schlafittchen. Aber Amadeus ist einer, der merkt, dass ihr das ernst ist. Und so treibt das Buch eben nicht auf die eigentlich erwartbare Katastrophe zu, sondern nimmt etliche Wendungen, die zuletzt auf die Rettung hinauslaufen. Denn wer auch nur ein bisschen Selbstachtung hat, dem geht es wie Amadeus und Nina – der will irgendwann raus aus dieser inszenierten Scheinheiligkeit. Und weil Nina clever ist, schaffen sie es auch.
Man ist mit dem kleinen Gerichtsachbearbeiter praktisch zu Gast in einer Welt, in der Millionen glauben zu Hause zu sein, weil sie jeden Tag darin eintauchen und dort ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit geprägt wird. Kein Wunder, wenn es dann auf den Straßen von Typen wimmelt, die sich kraftmeierisch geben wie Didi und die doch nur mit all dem prahlen, was sie in diesem Show-Kosmos aufgeschnappt haben. Musik, Geschmack, Anspruch – alles das sind Dinge, die man kaufen kann. Oder verkauft bekommt.
Nicht ohne Grund spricht Didi immer nur von den „consumern“, die beschissen werden wollen. Davon lebt er. Davon lebt eine ganze millionenschwere Branche. Und davon leben auch die großen deutschen Medienkonzerne – und nicht nur der eine im Buch. Sie produzieren Wunschbilder und Traumschlösser. Und sie haben seit über 70 Jahren an dem gebastelt, was heute die dümmsten Seppel in der Politik als Heimat zu verkaufen versuchen. Auch der deutsche Heimatminister.
Denn wenn die Leute, die diesen ganzen künstlichen Gefühlssalat konsumieren, über Heimat so denken, wie es die deutsche „Volksmusik“ immer wieder neu inszeniert, dann ist man wirklich im Tal der Deppen gelandet. Und spätestens die nächtlichen Alpträume sagen einem in aller Dringlichkeit: „Nur raus hier!“
Und so geht die Geschichte mal glücklich aus für Amadeus und Nina. Und man legt das Buch froh beiseite, weil man nun weiß, dass es wenigstens noch einen Bayern gibt, der sich von diesem Kuhglockengebimmel und Kufstein-Gejodel nicht narrisch machen lässt.
Das zweite Vogel-Tagebuch von Hauke Meyer
„Die Wächter“ – Zwei Jahre zwischen Birdrace, politischem Furor und der Suche nach dem Wichtigsten im Leben
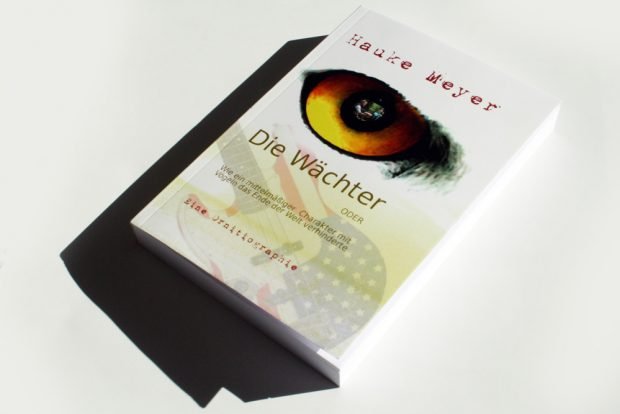
Hauke Meyer: Die Wächter. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserSo ganz im Reinen war Hauke Meyer nach seinem ersten Buch 2015 doch noch nicht. Er hatte sich ja bekanntlich aufgemacht, nicht nur die Vogelwelt rings um seinen Wohnort Einbeck im Leinetal zu erkunden, sondern auch mit sich selbst besser ins Reine zu kommen. Er ist ja nicht der Einzige, der kurz vor der 40 mit sich selbst haderte und sich seiner Rolle als Mann in dieser Welt vergewissern wollte. Was ja, wie wir nun erfahren, einfach nicht aufhört.
Da helfen alle Posen nichts: Männern geht es genauso wie Frauen. Jeden Tag müssen sie sich neu einfinden in ihr Leben, in sich hineinhorchen und versuchen, den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Erwartungen nahezukommen.
Und eines scheint mir nun nach diesem zweiten Buch, das Hauke Meyer schon begonnen hat zu schreiben, bevor auch nur das erste ausgeliefert war, ziemlich deutlich: Er wird auch diesem Buch ein weiteres folgen lassen müssen. Eigentlich sind es ja schon zwei in einem.
Denn das erste beschreibt sein Jahr 2015, ein Jahr, von dem er ja anfangs nicht ahnen konnte, wie es am Ende ausgehen würde. Aber nachdem er im ersten Buch seine Leser schon mitgenommen hat, mit ihm die reiche Vogelwelt im Leinetal zu entdecken und seine ganz persönlichen Beziehungen zur Welt, zu seiner kleinen Familie und zum Kosmos der Vögel zu beschreiben, nahm er sich für den nächsten Band einen regelrechten Rekordversuch vor: Binnen eines Jahres wollte er 250 verschiedene Vogelarten im Leinetal nachweisen.
Das Leinetal ist dafür bestens geeignet – es ist eines der artenreichsten Gebiete in Deutschland. Und es hat eine interessierte Gemeinschaft von Vogelfreunden – samt Vogelwarte. Das Denken ist dort schon ein ganzes Stück weiter als im geplagten Leipziger Auenwald, der bislang noch ein ebenfalls artenreiches Refugium ist – mit höchster Gefährdung. Über 100 Vogelarten soll es hier geben. Es würde sich also lohnen, genauso wie Hauke Meyer so oft wie möglich mit Kamera und Spektiv loszuziehen und nach seltenen Vögeln Ausschau zu halten.
Vielleicht nicht ganz so getrieben wie im ersten Teil des Buches, denn das geht schief. Was er dann im zweiten Teil auch reflektiert. Denn auch für einen Hobby-Ornithologen ist es eine Leistung, 250 verschiedene Vögel nachweisen zu wollen, erst recht, wenn Arbeit und Familie ihre Forderungen stellen und man die Gänge ins Vogelrevier Frau und Tochter regelrecht abtrotzen muss – wobei gerade die Kleine, die im ersten Band 3 Jahre alt war, im Verlauf des Buches immer mehr Interesse zeigt für das, was der Vater tut. Und natürlich hat er recht. So pflanzt man wichtige Erfahrungen in die Kinder ein, die sie ein Leben lang behalten.
Schon gar vor dem eigentlich bedrohlichen Hintergrund, der ihm immer wieder bewusst wird.
Etwa wenn er dem Kind ein Rebhuhn zeigt und sich an seine eigenen Kindheitserlebnisse erinnert, als es nicht um ein Rebhuhn ging, sondern um ganze Schwärme davon. Auch im Leinetal ist es viel stiller geworden. Viele Vogelarten, die die Wege seiner Kindheit begleiteten, sind selten geworden, gelten gar als ausgestorben. Noch sind sie da, stellt er fest: die Wächter. Denn damit meint er die Vögel, die sein Leben begleiten und die uns beobachten.
Doch die Ruhe, mit der er ins Buch einsteigt, trügt. Denn auch ein Ziel wie 250 verschiedene Vogelarten zu entdecken, bedeutet Leistungsdruck. Er flucht zwar immer wieder auf die Gesellschaft und ihre Besessenheit. Aber eigentlich hat er es selbst verinnerlicht. Da geht er auf die 40 zu und lebt doch ständig unter (Leistungs-)Druck.
Viele kleine Szenen mit seiner kleinen Familie wirken von außen richtig dramatisch, wenn er vom Tisch aufspringt und losstürzt und seine Frau mit einem kurzen Spruch abspeist. Er will etwas leisten und sich beweisen. Was in diesem Jahr gewaltig schiefgeht, als er bei seinem ersten Versuch, mit einem Motorroller zu fahren, stürzt und sich das Schlüsselbein bricht.
Dass da etwas in ihm tobte, stellt er hinterher fast beiläufig fest – unduldsamer sei er geworden, rücksichtsloser. Das bekamen seine beiden Gefährtinnen wohl auch immer wieder zu spüren.
Und endgültig scheint er im Herbst 2015 außer Rand und Band zu geraten, weil ihn die mediale Vermittlung der Flüchtlingsaufnahme empört. Er meint zwar, das sei angeboren, Männer seien nun mal so – echte freiheitsliebende Krieger. „Männer neigen dazu, das Leben als stetigen Krieg wahrzunehmen. Gegen sich selbst, gegen seine Frau, die Gesellschaft als solches. Gegen alles eigentlich. Ich kann nichts für meine genetische Veranlagung und bin sicher nicht nur von der Gesellschaft dazu gemacht, wie mir das einige übereifrige Forscher weismachen wollen.“
Dabei arbeitet er als Sozialpädagoge. Da verblüfft das schon. Weil er ja an anderer Stelle zu Recht bezweifelt, dass es „die Gesellschaft“ gibt. Gibt es ja auch nicht. Das ist ja der Punkt, an dem man dem Einbecker Eigenbrötler sofort zustimmen möchte. Die großen Raster sind falsch. Sie erzeugen eine Gemeinsamkeit, wo es keine gibt. Jedenfalls nicht in der Form.
Und schon gar nicht, wenn in einem Mann noch immer der jugendliche Punk steckt, der seinen Eigensinn gegen die ganze Welt behaupten will. Die Stars seines Lebens heißen „Status Quo“, Ramones und Gunter Gabriel. Doch die alten Barden sterben. Das Jahr ist überschattet von Todesmeldungen und auch Hauke Meyer schreibt vieles übers Altern und das Altsein. Mit 40? Man staunt. Da rumort es wirklich gewaltig in ihm.
Als er sein erstes Buch noch einmal liest, merkt er, dass es nicht ganz so besorgt und in Moll geschrieben war. Das zweite liest sich wehmütiger, mit einem fast tragischen Unterton: „Mein Leben. Eine Mischung aus Resignation, Lebensfreude, Zweifel und Protest in diesen Tagen. Wutbürger.“
Es scheint die Flüchtlingsdebatte zu sein, die ihn aufregt. Gleich will er sich das kritisierte Pirinci-Buch besorgen. Im zweiten Teil wird er gar zum Trump-Fan, obwohl er mit den deutschen Rechtsaußen nichts anfangen kann. Man merkt schon, wie er das alles im Grunde postwendend in seinen Computer schreibt und sich weigert, die Passagen, die möglicherweise auf Protest stoßen, zu löschen.
Es ist eine sehr ernsthafte Selbstbefragung – die (für den Leser) nicht immer zu logischen Erkenntnissen führt. Aber auch das ist Leben. Und hier versucht wirklich einer, sein eigenes Dasein zu fassen: Was macht ihn den besonders? Welche Rolle spielt er in der Welt?
So weit gehen nicht viele. Schon gar nicht mit sich selbst. „Auf der Hinterbühne der Vorderbühne bin ich gleichzeitig Zuschauer, Regisseur und Nebendarsteller. Freiheit ist ein Abenteuer. Die Freiheit, Lebewesen beim Sein zu beobachten, Glück und Inspiration.“
Da hat man ihn fast beieinander – einen, der viel grübelt, Momente der Ruhe zur Selbstreflexion nutzt, aber eben doch lieber alles allein klären will. Freiheitsdrang und Eigensinn. Am Ende dann sogar das Trump-T-Shirt, um genau diesen Eigensinn zu behaupten. Und man versteht ihn ein bisschen. Irgendwie brachte dieser Trump ja wirklich Wind in die (amerikanische) Politik.
Die Präsidentschaftswahl ist fast schon der Schluss des Buches, Ende 2016. Das Jahr hat Hauke Meyer genutzt, jetzt doch mit etwas mehr Ruhe und Besinnung auf Vogelpirsch zu gehen. Denn die 250 Vogelarten gleich im ersten Jahr alle sehen zu wollen, das hat nicht geklappt. Das hat nur enormen Stress verursacht. Und dabei sucht er ja bei der Beobachtung der Vögel genau das nicht.
Denn dass es selbst im vogelreichen Leinetal um so viel stiller geworden ist als in seiner Kindheit, das schwingt als Sorge immer mit. „Insgesamt aber ist es stiller geworden in der Welt. Gehe ich in Gedanken an die Orte zurück, an denen ich war, insbesondere die Wälder und Wiesen der Umgebung, dann ist Stille mein Begleiter gewesen. Eine gespenstische Ruhe.“
Nicht nur um die Insekten steht es schlecht, auch um unsere Vogelwelt.
„Einer der Gründe, warum ich dieses und das Buch davor geschrieben habe, ist auch von der Hoffnung genährt, dass mehr Menschen hinsehen und sich dafür interessieren, welche Kreaturen sie in ihrer Welt umgeben.“
Man muss seine politischen Ansichten nicht teilen. Sie sind stark auch geprägt von Eigensinn. Was eigentlich – in völlig anderer Beziehung – ein Ansatzpunkt wäre zu verstehen, was Männer eigentlich in einer Gesellschaft umtreibt, in der die (alten) Männerbilder nicht mehr zur Wirklichkeit passen. Und es geht ja nicht nur Punkern, Rockern und FDP-Wählern so, dass Freiheit auch immer ein Ort der Selbstbestätigung und Selbstbehauptung ist. Und Eigensinn eben auch eine Form der Freiheit – sich eben nicht mehr alles vorsetzen lassen zu wollen.
Was auch Haukes Grimm auf die Grünen ein wenig verständlich macht, die er mal gewählt hat, die er aber irgendwie als Bevormundungspartei begreift. Obwohl sie ihm in ihrem Kern ja nahe sein müssten – näher jedenfalls als unsere großen Konsum- und Wirtschaftsparteien.
Aber er trennt das. Und das zweite Jahr geht er ja sowieso ruhiger an, denkt auch mehr über große Themen wie Liebe, Mut und Freiheit nach. Und fast zum Schluss kommt er zum Kern dessen, was ihn fast jeden Tag in den Polder treibt. Ein Fasan ist seine Nummer 250. Aber ist es das, was am Ende zählt?
„Nein! Es geht nicht darum, dass ich irgendein ‚Birdrace‘ gewinne. Es geht darum, das Rennen zu beenden. Ja, es zu beenden. Aber danach ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen, es auch zu schaffen. Vielleicht habe ich gelernt, was wirklich zählt und wie wertvoll dieses Leben ist und wie schnell es uns genommen werden kann. Die Vogelbeobachtung hat mich gelehrt, für den Moment zu leben.“
Ein bisschen entschuldigt er sich noch bei den geschulten Vogelbeobachtern im Leinetal. Aber allein schon die schiere Zahl der unterschiedlichen Vögel, über deren Entdeckung er sich freut, zeigt dem ganz und gar nicht bewanderten Leser, dass es da draußen noch einen Reichtum zu entdecken gibt. Einen gefährdeten Reichtum. Schon für seine vierjährige Tochter fürchtet er, dass sie ihren Kindern nicht einmal mehr das zeigen kann, was er ihr zeigt, während sie beide auf der Bank sitzen und das Geflatter auf dem See beobachten.
Hauke Meyer Die Wächter, I.C.H. Verlag, Leipzig 2018, 15,90 Euro.
Claudia Kellnhofers Geschichten aus Kindheit und Leben
Eine Banane mag ich nicht oder Die Farben der richtigen Erinnerungen

Claudia Kellnhofer: Eine Banane mag ich nicht. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserWenn man so nach und nach ein bisschen älter wird, dann hat man was zu erzählen. Zumindest, wenn man Augen und Ohren aufgesperrt hat und aufmerksam war für die Schicksale seiner Mitmenschen. Aber wer tut das noch? Wer bewahrt noch die Geschichten seines Lebens auf? Setzt sich hin wie Claudio Kellnhofer und tut sich schwer mit der Schreibfeder?
Dabei ist sie Lehrerin, lebt mit ihrer Familie in Niederbayern in der Nähe von Regensburg. Und es verblüfft nicht, wenn man in ihren Geschichten Menschen begegnet, die nun eindeutig nur in Bayern zu Hause sein können, wenn auch mehr so an der bayerisch-tschechischen Grenze, wo die Autorin aufgewachsen ist und wo ihre stolze Mutter einen Kramladen betrieb. Es sind tatsächlich kleine Geschichten, keine Erzählungen. Darum ging es der Autorin auch nicht. Es ging ihr ums Aufbewahren und Erinnern.
Denn wer erinnert sich künftig noch an die Menschen in dieser Welt, die sich von unserer heutigen so deutlich unterscheidet? Es war keine reiche Welt. Das Märchen sitzt ja in den Köpfen vieler Zeitgenossen, die die Jahrzehnte nach dem Krieg einfach verklären und so tun, als könnten sie alles zurückdrehen und dann wieder goldenere Zeiten bekommen.
Zeiten ohne Zentralheizung, ohne Auto, ohne Supermarkt. Zeiten, in denen man noch aus Wollresten Strümpfe und Kleider strickte und die Leute Schlange standen im Kramerladen, wenn eine neue Büchse Fisch aufgemacht wurde, wo die Postbotin eine Standesperson war und der Auftritt von Akrobaten auf dem gespannten Hochseil eine Attraktion. Als Kinder noch zuhörten, wenn die Eltern (die noch lange keine Alten waren) vom Krieg erzählten. Der viel kürzer her war, als heute die untergegangene DDR.
Natürlich sind es ihre Kindheitsjahre, die Claudia Kellnhofer hier zu erzählen versucht. In lauter kleinen Geschichten, denn so erinnert man sie ja. Man zupft an einem Wollfaden – und dann tauchen die Bilder, die Stimmen, die Erinnerungen wieder auf. Tauchen auch die Menschen wieder auf, die einen prägten. Die Eltern natürlich. Zu denen einem dann auf einmal viele kleine Erlebnisse einfallen, die erst aus der Distanz eigentümlich wirken, staunenswert. Im besten Sinne eigentlich sensationell, weil sie an tiefe Gefühle rühren.
Auch wenn darin keine Sensationen passieren. Auch gar nicht passieren müssen. Denn wer es genau erzählt und auch so farbenreich wie Claudia Kellnhofer, der lässt eine Vergangenheit wieder lebendig werden, die nichts mit dem üblichen Erinnerungskitsch zu tun hat. Aber viel mit einer Realität, die im Moment der Ereignisse noch nicht verrät, wie vergänglich sie ist. Denn all die Menschen, die einen als Kind beeindrucken und regelrecht respekteinflößend sind, die verschwinden irgendwann.
Wenn wir Glück hatten, haben wir ihre Lebensgeschichte kennengelernt und können sie erzählen. Und damit aufbewahren. Und – was die Autorin auch mit Feingefühl zeigt – darin vieles wiedererkennen, was uns heute prägt. Etwa den Stolz und das Selbstbewusstsein von Frauen, die eigentlich vom Leben gebeutelt wurden, sich aber trotzdem immer wieder aufgerappelt haben, um die Dinge am Laufen zu halten.
Oder den Laden am Laufen zu halten, der die kleine Familie ernährt. Man merkt schon: Das ist eine andere Welt, als sie viele Menschen mit der heutigen Vollkasko-Mentalität im Kopf haben. Vielleicht hat sogar genau das Anteil daran, dass so viele Menschen verzagen, sich hilflos fühlen und machtlos in der Welt. Sie sehen nicht mehr das Machbare in ihrem Alltag, all die kleinen Handgriffe, mit denen sie ihre eigene Welt am Laufen halten. Oder die Schreinerei, mit der der Vater sein Geld verdient, nachdem sie ihm einmal völlig abgebrannt ist.
Hier barmt niemand. Hier packt jeder nur an und macht – trotz alledem – doch wieder etwas Vernünftiges draus. Und weil das Dorf klein ist, kennt jeder jeden. Man glaubt wohl, dass die Autorin noch viel mehr solcher Geschichten zu erzählen hat. Aber diese verflixte Schreibfeder …
Da kann man Lehrerin sein und trotzdem merken, wie schwer es ist, sich diszipliniert hinzusetzen und Erinnerungen in Sätze zu fassen. Denn Claudia Kellnhofer ist abgelenkt. Das gehört wohl zusammen. Wer früh schon lernt, dass das Leben voller Geschichten ist, und dabei Phantasie entwickelt hat, der gerät auch schnell ins Philosophieren. Was die zweite Hälfte des Buches zunehmend dominiert.
Denn da macht sich bemerkbar, dass ein gelebtes Leben auch eine zweite Hälfte hat. Eine, in der man nicht mehr ganz so verwundert auf den Anfang guckt, dafür mit einer seltsamen Neugier auf das mögliche Ende. Denn wenn man die zuweilen eindrucksvollen Sterbefälle im Dorf erzählen kann, dann liegt ja auch die Frage nahe: Wie willst du eigentlich deinen eigenen Ausgang aus dem Leben gestalten?
Die Kinder und Enkel von Claudia Kellnhofer können es in diesem Buch nachlesen. Aber dabei belässt sie es nicht. Denn wenn man schon mal an den Tod denkt, dann darf man auch an die mythische Dimension dabei denken – an einen glücklichen Sisyphos zum Beispiel, die Rolle von Lilith oder die von Tutenchamun. Denn alle die alten Mythen erzählen ja auch wieder von unserem Menschsein. Und dem Wert, den wir unserem Leben und uns selbst beimessen. Oder wie aufmerksam wir dafür sind, was um uns herum passiert.
Da hat sie also mit den Findlingen aus ihrer Kindheit begonnen und landet im großen Strom der Mythen und der Frage nach dem richtigen Tod. Was auch nicht zufällig ist, nicht nur wegen der christlichen Rahmung einiger dieser Kindheitsgeschichten, sondern auch wegen zweier dieser erinnerten Geschichten. Gab es den Mann wirklich, der da irgendwo in Bayern in seinem Garten eine richtige Arche Noah gebaut hat? Und den Mann, der sein Leben darauf verwendet hat, eine richtige Pyramide zu bauen?
Möglich ist das schon. Besser kann man ja gar nicht aussteigen aus diesen ganzen Erwartungen, die unsere Kauf-und-schmeiß-weg-Gesellschaft an die Menschen richtet. Und damit wohl Generationen hervorbringt, die künftig mal nichts zu erzählen haben. Weil sie gar nicht die Ruhe und die Aufmerksamkeit hatten, den Geschichten der anderen zuzuhören und Menschen in ihre Gedankenwelt hineinzulassen.
Claudia Kellnhofer ist noch in einer Welt aufgewachsen, in der man diesen Raum der Aufmerksamkeit füreinander hatte – Pech für ihre augenscheinlich doch sehr verschlossene Mutter. Denn dann bekommt man als Kind trotzdem vieles mit. Vieles, das irgendwann erzählt sein will. Wie eine Flaschenpost für jene, die dieses Buch mal in die Hand bekommen. Manchmal spricht sie die Autorin auch an, als säße man gerade beisammen und würde sich etwas erzählen aus unvordenklichen Zeiten.
Diese unvordenklichen Zeiten liegen aber gerade einmal ein halbes Jahrhundert zurück. Und wenn wir nicht aufpassen, erzählen uns die Nix-Merker, wie das damals war. Deswegen sind diese Erinnerungsgeschichten so wichtig. Weil sie wirklich erzählen, was war. Und es war nicht schlecht, es war aber auch kein Schlaraffenland. Es war genau das, was Menschen einen Halt gibt, wenn sie ihren Erinnerungen vertrauen.
Und dass es strenge alte Damen gab, die Bananen aus Prinzip nicht essen wollten, weil sie mit dem Bild der bananenpflückenden Schwarzen nicht zurechtkamen, gehört auch zu dieser Geschichte. Und zu dem Wissen, dass die Welt sich fortwährend verändert. Eine Welt, die bei genauerer Betrachtung auch immer ganz anders war, als die Leute so daherreden, wenn der Tag lang ist und der Empörungspegel hoch.
Claudia Kellnhofer Eine Banane mag ich nicht, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2018, 13,40 Euro.
Eine fatale Reise von Florenz nach Avignon
Mit Dieter Moselt im finsteren Pestjahr 1348 unterwegs

Dieter Moselt: 1348. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserSabine Ebert hat es ja vorgemacht, wie man mit einfachen Jahreszahlen auf dem Buchcover Interesse weckt für historische Romane. Mit 1813 und 1815 können seither viele Liebhaber historischer Romane etwas anfangen. Aber wie ist das mit 1348? 1348 war ein fürchterliches Jahr. Denn in diesem Jahr wurde die Pest zur europäischen Pandemie. Selbst die Jahresseite von Wikipedia macht mit dieser Katastrophe des Jahres 1348 auf.
Italien, Griechenland, der Süden Frankreichs sind – nachdem die Pest im Jahr zuvor schon in der Türkei und auf Sizilien wütete – fest im Griff des Schwarzen Todes. Ein Jahr später würde auch der Großteil Deutschlands zum Opfer. Die Hälfte der europäischen Bevölkerung würde bis 1353 an der Pest sterben. Das Ereignis wütete also schlimmer als der 30jährige Krieg. Keine gute Zeit also für eine Reise von Florenz nach Avignon, auf die Dieter Moselt in dieser Geschichte seine Protagonisten schickt. Es kann nur eine fürchterliche Reise werden und man merkt schnell, dass Dieter Moselt mit dieser Geschichte versucht, einen dunklen Kontrapunkt zu all den zumeist von Romantik triefenden Mittelalterromanen zu setzen, die in den Buchhandlungen ganze Regale füllen und in denen Nonnen, Huren, Spielleute, Ritter und andere wundersam glückliche Gestalten ihre großen Abenteuer erleben.
Sein großes Vorbild benennt Moselt sogar in einer Fußnote: Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ (1980), der im Jahr 1327 beginnt – also noch in glücklicheren Zeiten, Zeiten, in denen die Pest seit fast 600 Jahren aus Europa verschwunden war. Den Arabern sei Dank. Die Forschung geht davon aus, dass die Unterbrechung der alten Handelswege nach Afrika durch die Araber dazu führte, dass der Pesterreger nicht mehr nach Europa eingeschleppt wurde.
Umso härter schlug die Pest ab 1348 zu. Das Mittelalter stand in Blüte, die Städte erlebten ihre große Renaissance und die großen Seefahrerstädte Venedig, Pisa und Genua schufen die neuen Handelsrouten der mittelalterlichen Globalisierung. Etwas, was Moselt nicht extra thematisiert: dass Globalisierung auch ihre negativen Seiten hat und hatte. Und dass die Menschen darauf bis heute irrational reagieren.
1348 mit ausufernden Judenverfolgungen, Geißlerumzügen und anderen Formen radikaler Büßerbewegungen. Denn man empfand die Pest nicht als Ergebnis des blühenden Handels mit Afrika und dem Nahen Osten, sondern als Strafe Gottes. Wobei es 1348 wohl die Genueser waren, die die Pest aus Kaffa auf der Krim, das sie gegen die Goldene Horde verteidigten, nach Zentraleuropa brachten. Nur wussten die Bewohner dieser Zeit nichts über diese Zusammenhänge. Sie wussten auch über Hygiene nicht viel.
Die Zustände, die Moselt schildert, sind historisch belegt. Von den auf die Straße gekippten Fäkalien über die miserablen Wirtshäuser bis hin zum Irrglauben, Waschen und Baden würde gar der Ausbreitung von Krankheiten dienen. Mit den heute so schön restaurierten Innenstädten von Florenz und Pisa hat das, was der Florentiner Tuchhändler Giovanni Boccioni in Moselts Buch zu sehen (und zu riechen) bekommt, nichts zu tun.
Über Pisa und die ligurische See lässt er seine Tuchhändler nach Montpellier und von dort weiter nach Avignon reisen, wo der Papst seit Jahren im Exil lebt. Ihm wollen sie ihre wertvollen Stoffe verkaufen. Doch unterwegs können sie niemandem vertrauen, denn die Pest hat alle Verhältnisse ins Wanken gebracht. Bettler, Söldner, Diebe und Mörder machen Städte und Straßen unsicher.
Man merkt, wie wichtig Moselt diese Dinge sind, wie er sich in die Literatur eingearbeitet hat und mit sehr modernem Entsetzen schildert, wie sich die Menschen in dieser Zeit benahmen, wie dicht bei ihnen wilder Aberglaube und ungehemmte Sexualität beieinander lagen. Einen anderen Schriftsteller, der aber eindeutig auch eine Rolle in seinem Erzählen spielt, benennt er nicht: Das ist Giovanni Boccacio, der sein berühmtes „Decamerone“ genau in jenem Jahr der Pest 1348 schrieb. Etliche der frivolen Geschichten – angefangen mit dem beischlaflüsternen Mönch, der dem Helden der Geschichte die Frau abspenstig macht – scheinen direkt aus einer der Geschichten des „Decamerone“ zu stammen.
Es vermischen sich also die Erzählwelten. Wenn Moselt Wirte, Priester und Kaufleute auftreten lässt, klingt selbst der eigenwillige Ton der Scottschen Mittelalterromane an. Nur dass den Helden der Geschichte kein Glück beschieden ist. Und in die Ränke der Mächtigen mischen sie sich auch nicht ein, obwohl das französische Exil der Päpste und der politische Kampf um die Macht in Italien die Zeit bewegt haben muss.
Aber die Frage, die sich Moselt gestellt hat, war ja auch eher: Wie erlebten ganz normale Reisende so eine Tour mitten in einem ausgesprochen kalten Winter quer durch Norditalien und übers stürmische Mittelmeer? Wie sahen sie das erst kürzlich von der Pest heimgesuchte Montpellier und das ebenso verheerte Avignon, wo sich der Papst in seiner Burg vor allen Unbilden der Welt abgeschlossen hatte?
Es steckt ein großer Atem in dieser Erzählung. Und eigentlich das Sitzfleisch für mehrere Jahre Arbeit. Aber das ist nicht Moselts Ding. Er will einfach erzählen, was ihn bewegt. Und das sind die fatalen Zustände dieses seltsamen Jahres 1348, fatal auch deshalb, weil man sich beim Anblick dieser faszinierenden mittelalterlichen Städte heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie die Menschen damals tatsächlich lebten, wie kurz sie lebten und wie Krankheit, Verbrechen und Gestank allgegenwärtig waren.
Das hohe Mittelalter war weder gesund noch romantisch. Und die hohen Mauern und Türme, die wir heute bewundern, waren tatsächlich bitter notwendiger Schutz gegen Gewalt und Übergriffe, die auch die streitenden Fürsten der Zeit nicht unterbinden konnten.
Manchmal braucht man so einen farbenreichen Blick in eine Vergangenheit, die so weit entfernt noch gar nicht ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Wissenschaft und Aufklärung in den letzten Jahrhunderten tatsächlich alles verändert haben. Um den Papst, den im Titel genannten Popen, geht es im Buch eher nicht, auch wenn die Tuchhändler dem aufgedunsenen Clemens VI. in seinem Papstpalast tatsächlich begegnen. Die Reise endet gänzlich fatal – auch noch mit einer Hinrichtung. Auch wenn man am Ende merkt, dass Moselt eigentlich nicht noch mehr Grausamkeiten erzählen möchte.
Irgendwie ist er fertig mit diesem Jahr 1348 und dieser Zeit und ziemlich froh, in der Gegenwart auf einer sauberen italienischen Piazza sitzen zu können, seinen Espresso trinken zu dürfen und sich eines Methusalemalters von 73 Jahren erfreuen zu dürfen, das im 14. Jahrhundert nur den Allerwenigsten vergönnt war.
Dieter Moselt „1348. Der Pope sitzt in Avignon“, Einbuch Buch-und Literaturverlag, Leipzig 2018, 13,90 Euro
Wenn die eigenen Gefühle tief unterm Panzer stecken
Majas langer und tränenreicher Weg aus dem Missbrauchs-Trauma zu einem neuen, lebendigen Ich

Maja Marlen Hope: Vom zersplitterten Spiegel zum bunten Mosaik. Foto: Ralf Julke
Vor einem Jahr sorgte Annett Leander mit ihrer wütenden Kindheitserinnerung „Umarme mich – aber fass‘ mich bloß nicht an“ im Einbuch Verlag für richtig Aufmerksamkeit. Das Thema hatte es ja in sich: Missbrauch in der Familie. Doch sexueller Missbrauch findet nicht nur in von Alkohol gezeichneten prekären Familienverhältnissen statt. Und die Folgen sind immer heftig.
Darüber schreibt in diesem Buch die Österreicherin Maja Marlen Hope. Bei ihr steht freilich die schwere, zermürbende Aufarbeitung des Traumas im Vordergrund. Denn sie gehört wohl zur Mehrheit der Betroffenen, die die frühen, traumatischen Erlebnisse lange verdrängt haben, abgekapselt irgendwo im Unterbewussten, weit weg von ihrem Leben, das sie augenscheinlich mit viel Erfolg, Leistungs- und Abenteuerlust verbringen. Bis zu dem Moment, an dem sich der Körper selbst zu Wort meldet und einfach streikt. Denn das auf Hochtouren gebrachte Leben mit einem enormen Arbeits- und Leistungspensum, das so gut zu unseren heutigen Vorstellungen von dem passt, was wir glauben aus unserem Leben machen zu müssen, entpuppt sich auf einmal als etwas, was auch Maja Marlen Hope so nicht gedacht hätte: als regelrechte Flucht nicht nur vor den bedrückenden Erinnerungen, sondern auch vor ihren eigenen Gefühlen.
Als gar nichts mehr geht, entschließt sie sich, zurückzukehren in ihre Heimatstadt und sich den eigenen Verletzungen zu stellen, therapeutisch Hilfe zu suchen und vor allem den Onkel, der ihr das angetan hat, vor Gericht zu bringen – freilich nicht ahnend, dass nicht nur Menschen zum Verdrängen von Dingen neigen, die sie nicht wahr haben wollen, sondern auch ganze Apparate. So wird ihre Begegnung mit der Justiz tatsächlich zu einer Wiederholung des Traumas und zur Begegnung mit Männern, die all ihre Macht darauf verwenden, Opfern das Geschehene ausreden und Täter vor jeder möglichen Strafe schützen zu wollen. Dass sich der österreichische Staat genauso verhält und am Ende jede Unterstützung mit fadenscheinigen Argumenten versagt, spricht für sich.
Würde Maja nicht im Verlauf ihrer langen quälenden Reise zu sich selbst auch Menschen kennenlernen, die ihr trotzdem in den schwärzesten Stunden beistehen, sie hätte die Tortur wohl nicht durchgestanden. Denn für die Opfer eines Missbrauchs ist die Aufarbeitung immer eine Tortur. Sie brauchen dabei nicht nur professionelle Begleitung, die tief vergrabenen Erlebnisse und Verletzungen aufzuarbeiten. Sie brauchen auch Menschen, die in den Stunden und Tagen danach bereit sind, ihnen Halt und Trost zu geben. Denn was da erweckt wird, sind natürlich die unverhüllten, jahrelang ignorierten Gefühle des verletzten Kindes.
Das eben nicht nur körperlich verletzt wurde, sondern in seinem tiefsten Vertrauen missbraucht wurde. Es ist nicht nur bei Maja so: Die meisten Missbräuche geschehen im engsten Familienkreis und durch Personen, die für die Kinder und Jugendlichen eigentlich Vertrauenspersonen sind, geliebte und oft sogar angehimmelte Familienmitglieder. In diesem Fall der Onkel, der zudem die Fähigkeit besitzt, Menschen, mit denen er zu tun hat, zu manipulieren. Dass Maja das Erlebte so lange verdrängen konnte, hatte auch mit der Drohung des Onkels zu tun, sie dürfe niemals darüber reden. Aber auch mit dem schäbigsten aller Momente, als er das Mädchen mit Beginn der Pubertät regelrecht erniedrigte und wegschickte mit der Behauptung, jetzt gefiele sie ihm nicht mehr.
Zu einem Gerichtsprozess gegen den Mann ist es nicht gekommen. Der zuständige Staatsanwalt weigerte sich einfach, sich mit dem Fall ernsthaft zu beschäftigen.
Dabei ging es Maja auch nicht um Strafe oder Rache, sondern eher um Einsicht und eine Entschuldigung. Doch die bekam sie nicht. Im Gegenteil. Die Großeltern deckten lieber den Täter.
Majas Eltern und ihre Schwester aber hielten zu ihr, so dass sie auch etwas entdecken konnte, was sie vorher nie zugelassen hätte: Sie um Hilfe zu bitten in der Not.
Denn wenn Vertrauen derart gründlich zerstört ist, dann wird das Opfer sich ein Leben lang mit Sätzen plagen wie „Ich bin es ja doch nicht wert“ oder „Ich habe gar nicht verdient, dass mich jemand liebt, so wie ich bin“ usw. Die Therapeuten werden all das nur zu gut kennen. Denn die Zahlen sind hoch. Der verdrängte Missbrauch macht die Betroffenen immer wieder zum Opfer, denn wenn sie die Muster nicht kennen, suchen sie sich auch immer wieder Partner, die das Trauma bestätigen, sie erleben neue Erniedrigung und Zurückweisung. Und wandeln es im Kopf in harmonische Beziehungen um.
Doch im Unterschied zu vielen Betroffenen, die sich der bedrückenden Last nicht stellen wollen, nimmt Maja die Herausforderung an. Sie kämpft, sucht sich Hilfe und Freunde, lernt auch noch Yoga und Kampftechniken, um auch ihren Körper besser verstehen zu lernen. Und je tiefer sie sich in die schmerzlichen Erinnerungen und in die Schutzpanzer ihrer Emotionen hineinarbeitet, umso hellsichtiger wird sie auch im Blick auf ihre Mitmenschen. Sie merkt, dass es nicht ihre Emotionen sind, die sie betrügen, sondern ihre Vernunft, die so lange Jahre hilfreich war, weil sie dafür sorgte, die Verzweiflung fernzuhalten. Doch damit war auch all ihre Lebendigkeit, ihre Sexualität und ihr Selbstvertrauen unter Verschluss. Sie funktionierte nur noch und war in Liebesbeziehungen immer das suchende, unterwürfige Kind.
Das Buch hat Maja Marlen Hope quasi zum Abschluss ihrer Trauma-Therapie geschrieben, an dem Punkt, an dem für sie endlich greifbar war, was sie alles verdrängt hatte und was das mit ihrem Körper und ihren Emotionen angestellt hatte. Sie hatte sich den schlimmsten Erinnerungen gestellt. Ob die Reise in die Tiefe am Ende heilsam war, weiß sie noch nicht. Doch allein die Intensität der Beschreibung dessen, was sie in den drei Jahren erlebt, erzählt von einer unbändigen Lust aufs eigene Leben. Sie hat nicht nur Vertrauen neu gelernt und das zutiefst verletzte Kind in sich gefunden. Sie hat auch die Sensibilität eines Körpers gefunden, der ihr scheinbar über all die Jahre fremd war.
Natürlich ist es ein Buch, das anderen, die Ähnliches erlebt haben, Mut machen soll. Auch wenn es höchst emotional ist. In Tagebuchauszügen taucht die Autorin immer wieder in die vergangenen Phasen der Therapie zurück. Sie lässt auch die heftigen Abstürze nicht weg. Denn wenn man solche Erfahrungen über Jahre tief verschlossen hat, dann ist die Begegnung mit ihnen heftig. Dann kommen selbst Erlebnisse aus der jüngeren Vergangenheit wieder hoch – und die Autorin erschrickt. Denn augenscheinlich hat ihre Vernunft auch später in gefährlichen Situationen immer wieder auf Verdrängung geschaltet, so dass sie sogar von Glück sagen kann, dass sie lebendig bis an den Punkt gekommen ist, an dem sie sich der Sache stellen konnte.
Und natürlich macht das Buch sehr nachdenklich. Denn wenn diese Dinge so oft passieren, was richtet das eigentlich mit unserer Gesellschaft an? Wie viele Menschen tragen diese Erfahrungen in sich, unfähig, daran auch nur zu rühren? Hängt die panische Flucht vieler „Leistungsträger“ unserer Gegenwart vor Verständnis, Mitgefühl und Emotionen vielleicht sogar genau damit zusammen: mit dem Verdrängen? Kann es sein, dass die heutige Anhimmelung des permanent Verfügbaren genau damit zusammenhängt: Eine ganze Gesellschaft stürzt sich lieber blindlings in Dauerhöchstleistungen, um sich ja nie den Verletzungen zu stellen, die ihre Leistungsträger erlitten haben?
Und wie ist das mit diesen erfolgreichen Manipulateuren, die ihre ganze Umgebung dazu bringen können, sie anzuhimmeln und immer wieder neuen Missbrauch von Vertrauen zu ermöglichen? Die sich gegenseitig schützen gegen Anklagen und Machtentzug? – Alles nicht ganz abwegige Fragen. Die aber natürlich über das Buch hinausgehen, das vor allem davon erzählt, dass es sich lohnt, um seine eigene Heilung zu kämpfen, sich echte Freunde und Unterstützer zu suchen und die falschen Programmierungen im Kopf aufzulösen, die einst so wichtig waren, um das Überleben zu sichern, die irgendwann aber selbstzerstörerisch werden. Denn wenn man keinen Zugang mehr hat zu seinen eigenen Emotionen, wenn man sich dem Leben nicht mehr gewachsen fühlt, dann neigt man logischerweise zum Aufgeben. Dann behalten die Botschaften des falschen Über-Ich Recht. Eine scheinbar ausweglose Situation, wenn man nicht – wie Maja – darum kämpft, das Verlorene und Verschlossene wiederzugewinnen, wieder eins zu werden mit sich.
Es ist – das weiß man nach dem Lesen dieses Buches – ein hartes und tränenreiches Stück Arbeit.
Aber auch ein erhellendes, denn Maja lernt auf ihre Emotionen zu achten und die zerstörerischen Männer zu meiden. Denn Männer, die ihre Beziehungen nur danach bewerten, wie viel Macht sie über ihre Partner haben, gibt es genug. Männer, die selbst voller unverarbeiteter traumatischer Erlebnisse aus der Kindheit sind, auch. Lösen kann man das nur, indem man sich wirklich – wie Maja – dem eigenen Klärungs- und Heilungsprozess stellt. Und auch wenn es schwer ist, zeigt die Autorin mit ihrem Buch, dass es geht, dass man Freunde und Freundinnen findet, die einem helfen dabei, ein Netzwerk von Menschen, die einen verstehen, trösten und tragen. Die einem ein Stück weit genau das zurückgeben, was der Täter einst zerstört hat: das Vertrauen zu nahestehenden Menschen und vor allem in die eigene Kraft und Lebendigkeit.
Maja Marlen Hope Vom zersplitterten Spiegel zum bunten Mosaik, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2016, 14,90 Euro.
Krimi, Welten-Saga, Dystopie?
In Kurt M. Simons Sci-Fi-Krimi lebt der alte Glaube wieder auf, dass die Menschheit vielleicht doch zu retten ist
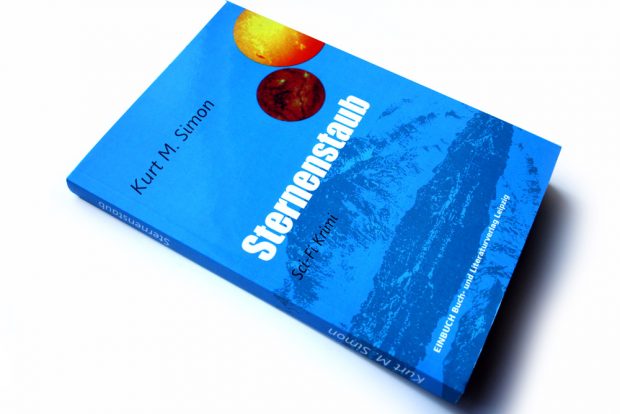
Kurt M. Simon: Sternenstaub. Foto: Ralf Julke
Die Latte liegt hoch, auch wenn man sich in ein fast schon wieder unmodern gewordenes Genre traut: die Sternen-Saga. Denn dahin tendiert Kurt M. Simons „Sci-Fi-Krimi“, wie er ihn einsortiert hat – was wieder neue Maßstäbe setzt. Und eine Dystopie sollte es auch noch werden. Klassiker wie Heinlein, Asimov oder Herbert hätten daraus einen dicken 500-Seiten-Sternen-Wälzer gemacht.
Mittlerweile tauchen die Bücher aus diesen raumfahrtbesessenen 1950er, 1960er Jahren ja wieder in den Buchhandlungen auf – neu eingewickelt, wie Zeugnisse eines verschrotteten Zeitalters. Und Fakt ist: Seit die USA und die einstige Sowjetunion ihren Wettlauf im Weltall beendet haben und die Sache eher nur noch so vor sich hindümpelt, wagt sich kaum ein SF-Autor mehr an Romane über Sternenreisen. Oder gar – wie Heinlein – an die Konstruktion ganzer besiedelter Welten.
Man mag ja auch nicht mehr dran glauben, dass es diese zerstrittene Menschheit jemals schafft, den Planeten zu verlassen. Statt Geld in die Raumfahrt zu stecken, werden Billionen-Summen für immer neue Rüstungsprogramme aufgewendet, in Waffenarsenale versenkt, deren Zerstörungskraft so groß ist, dass nach einem Knopfdruck eigentlich nichts mehr von menschlicher Zivilisation übrig bleibt. Und die Sternengenerale, die mit dummem Blick in die Kameras behaupten, man müsse der Sicherheit halber wieder die Rüstungsetats erhöhen und die potenziellen Gegner erschrecken, sind ja alle wieder da.
Da hat ein kleines Kapitel Entspannungspolitik einfach nicht gereicht, was draus zu lernen.
Und so ist das Grundszenario, das Simon wählt, erst mal so plausibel wie oft durchgespielt: Ein Idiot hat auf den roten Knopf gedrückt, die irdische Zivilisation ist in einem Feuerinferno untergegangen. Übrig blieb nur noch eine nicht von Atomexplosionen zersiebte Insel in Afrika, dem Kontinent, der eher nicht Zielgebiet der modernen Atomsprengköpfe ist. Und Simon ist ganz mutig: Er zeichnet das Bild einer Zivilisation, die sich selbst wieder am Schopf aus der Patsche gezogen hat, nicht nur in Afrika eine Insel des Überlebens geschaffen hat, sondern auch den Sprung auf den Mars geschafft hat und – über eine dieser legendären Einstein-Rosen-Brücken, die die SF noch in den 1980er Jahren in Begeisterung versetzt haben – den Sprung auf einen Planeten in einem anderen Sternensystem, Artemis mit Namen. Ausführlich schildert Simon, wie diese Menschen der Zukunft nach dem Tag X neue Regeln für ihr Zusammenleben aufgestellt haben in der Hoffnung, damit die Fehler der Vergangenheit vermeiden zu können.
So betrachtet: Ein hochaktuelles Buch. Man kann ja direkt zuschauen, wie lauter Typen mit defekter Sozialisation und der Gier nach Geld, Macht und Ruhm gerade Gesellschaften zum Brodeln bringen und politische Entscheidungen ins Rollen, die die wenigen so schwer errungenen Schutzschilde gegen die nationalistischen Katastrophen des letzten Jahrhunderts wieder demolieren. Als steckte in den Menschen – auch dann, wenn sie in einer Demokratie leben dürfen – ein unbändiger Zerstörungstrieb, als würden sie alle in ihrer Lebenszeit erleben wollen, wie das ist, wenn man einfach mal alles auf die Spitze treibt.
Natürlich funktioniert das so einfach nicht, obwohl die medialen Verstärker heute ziemlich einhellig dafür sorgen, jenen Erfolg zu verschaffen, die am lautesten, rücksichtslosesten und egoistischsten agieren.
Und wahrscheinlich ist es wirklich so, wie Simon versucht, anhand der Ereignisse auf Artemis zu schildern, dass Menschen, die Macht über andere haben wollen, immer Wege dazu finden. Und wenn es nicht der schnelle Weg ist, dann ist es der langsame über die lange Okkupation der Macht durch einflussreiche Familien, denen es auch egal ist, ob ihre Kandidaten für die mächtigen Ämter nun verantwortliche Leute oder ausgebuffte Verbrecher sind. Dieses Artemis erinnert ein wenig an die großen Familien des italienischen Mittelalters, die so mächtig waren, dass niemand es wagte, sich mit ihnen anzulegen. Sie haben auch Justiz und Polizei infiltriert. Und bei Simon geht diese Geschichte am Ende nur deshalb gut aus, weil es jenseits der regionalen Polizei – zu der sich seine Heldin Yasemin versetzen lässt – noch eine Cosmopolizei gibt, die augenscheinlich über Möglichkeiten verfügt, die tatsächlich auch die Macht auf Artemis übersteigen.
Yasemin ist Polizistin und steigt auch deshalb in den Fall ein, weil sie mit dem frisch gewählten Gouverneur von Artemis noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Dabei gerät nicht nur sie selbst in Gefahr, die Jagd nach einem mutmaßlichen Pädophilenring endet auch für einige Polizisten tödlich.
Es geht also noch hübsch durcheinander. Gerade weil Kurt M. Simon augenscheinlich zu viel auf einmal will. Immerhin hat sich auch das Thema einer ganz und gar digitalisierten Welt ins Buch geschummelt, in der der Einzelne eigentlich nur existiert, wenn er auch als digitaler (Staats-)Bürger registriert (und damit jederzeit überwacht) ist. Ein Thema, das von William Gibson schon viel genauer, atmosphärischer und auch konsequenter erzählt wurde. Dystopischer sowieso, weil er sich ganz auf diese unsere heutige Welt eingelassen hat und die enorme Machtgier thematisiert hat, die eben nicht nur Politiker und Geheimdienste haben, sondern auch riesige Konzerne, die aus den Daten der Menschen ihr Geschäft machen. Die dadurch aber eben auch zu einem enormen Moloch einer durch nichts legitimierten Macht werden. Denn wer die Daten hat, bestimmt über Wohl und Wehe der einzelnen Menschen.
Eigentlich ist auch Simons Welt so durchdigitalisiert. Doch irgendwie ist er mit den Handlungsmustern der frühen „Raumkadetten“-Romane von Asimov aufgewachsen. Da siegt nun einmal am Ende die gute Seite. Daran glaubten auch die SF-Autoren der goldenen Ära mit aller Kraft, wenn man mal von den unverbesserlichen Pessimisten absieht – Leuten wie Vonnegut oder Bradbury, die die menschliche (vielleicht auch eher die amerikanische) Zivilisation rettungslos der Selbstzerstörung ausgesetzt sahen, dem Agieren von männlichen Großmäulern, die irgendwie immer den festen Willen haben, sich zu Diktatoren aufzuschwingen und dem Rest der Welt mit einem Druck auf den Knopf zu zeigen, wo der Hammer hängt.
Da bleibt natürlich kein großer Glaube mehr daran, dass die möglichen „Weltpolizisten“ am Ende tatsächlich die weißen Ritter sind, die die Welt retten. Auch wenn die Botschaft so vertraut wirkt. Der Leipziger SF-Autor Timo Hemmann nutzt sie ja als Generallinie all seiner Romane: Wer Kinder rettet aus den Finsternissen von durchgeknallten Systemen oder Verbrechern, der rettet eigentlich die Welt. Zumindest für den Moment. Denn für gewöhnlich kann ein Teil des Bösen immer entwischen. Und ganz so sieht es auch hier aus: Die Sache geht gut aus, der Sonnenuntergang ist prächtig. Aber von den mächtigen, beim Tricksen erwischten Familien sind etliche entflohen auf einer Armada von Raumschiffen, in wildem Zickzack-Kurs, so dass sie am Ende nicht mehr verfolgt werden konnten. Stoff genug also für die nächste dramatische Geschichte. Denn solange das Böse in der Welt ist, wird es immer neue Rettet-die-Welt-Geschichten geben.
Kurt M. Simon Sternenstaub, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2016, 13,40 Euro.
Eine eher bedrückende Dystopie über ein fabelhaftes Land in Europa
Wie schnell wieder der Tod regiert, wenn kleine eitle Männer die Macht an sich reißen

Dieter Moselt: Wer die Wahrheit sagt … Foto: Ralf Julke
Das Land, von dem Dieter Moselt in dieser satirischen Erzählung berichtet (zumindest hat er sie so klassifiziert), liegt irgendwo in Europa, auch wenn der Name Miracolandia eher an die phantastischen Erzählungen des Barock erinnert, an Shakespeare oder Swift. Aber dieses Miracolandia liegt mitten in Europa und es regiert ein kleiner, eitler Narziss namens Baerenlustkoenig.
Die Geschichte scheint in einem ein klein wenig zurückliegenden Kapitel der europäischen Geschichte zu spielen. In einer Zeit, in der die machtgierigen kleinen Männer noch problemlos Präsident werden konnten, ohne dass es gleich den Kontinent zerfetzte. Auch wenn die wacheren Bewohner des Kontinents schon zu Recht alarmiert waren, denn diese Männer demonstrierten ja schon mal für alle, was sie mit den Ländern anstellen würden, wenn sie erst mal alle Machtbefugnisse in Händen hätten. Da muss man nicht erst ins heutige Polen, nach Ungarn oder in die Türkei schauen.
Das haben ganz andere Typen schon vorgemacht, wie man eine Demokratie unterhöhlt, sich die Presse kauft (wenn man nicht schon ihr Besitzer ist), nicht nur Ministerposten mit unterwürfigen Erfüllungsgehilfen besetzt, sondern auch Posten in Polizei und Justiz. Die Populisten von heute kommen ja nicht frisch aus der Werkstatt. Die Geschichte der Parteien, in denen macht- und öffentlichkeitsgierige kleine Männer die Strippen zogen und ziehen, ist ja viel länger. Und sie haben alle gezeigt, wie man Politik zum Zirkus machen kann, wenn man nur laut, unverschämt und rücksichtslos genug vorgeht.
Gelernt haben die etablierten Parteien in Europa daraus nichts. Auch nicht, welche Steilvorlage sie bieten, wenn sie sich von den Pöbeleien dieser Leute treiben lassen, Kompromisse eingehen und vor allem die eigentlichen moralischen Werte aufgeben.
Was diese Leute dann anrichten mit dem Land, das sie quasi in Geiselhaft nehmen, hat Dieter Moselt versucht, sich anhand einer Konstellation auszumalen, wie sie vor einigen Jahren in Europa herrschte. Wir verraten jetzt mal nicht, welches Land und welchen dreisten Alleinherrscher er sich da als Schablone genommen hat – er hat seine Erzählung ja nicht ohne Grund eine „satirische“ genannt und im Vorspann beteuert, dass alles nur Erfindung ist und gar keine konkrete Person der Gegenwart sich gemeint fühlen dürfte.
Aber herausgekommen ist im Grunde eine Dystopie, so etwas, was Kurt Vonnegut in seinen düstersten Erzählungen gemacht hat, der für die USA ganz ähnliche Abstürze in finstere diktatorische Zeiten befürchtete. Die Rezepte, zu denen diese Machtgierigen greifen, sind sich allesamt ähnlich. Zumeist beginnen sie damit, die Gesetze in ihrem Sinne umzuschreiben, die Gerichte zahnlos zu machen – und dann werden die Medien gleichgeschaltet, werden kritische Zeitungen mundtot gemacht und die öffentlichen Sender auf Parteilinie getrimmt. Alles pure Gegenwart.
Und die Leute, die das auch in Deutschland machen wollen, sind längst unterwegs.
Es ist also ein Büchlein passend zur Zeit. Das Drama entspinnt sich um die telegene Nachrichtensprecherin Irene Brando, die lange versucht hat, sich dem System Baerenlustkoenigs anzupassen, der sich der Einfachheit halber schon mal King nennen lässt. Erzählt wird aus der (ratlosen) Perspektive des Rentners William Martin, der mit den Brandos befreundet ist, aber hilflos zusehen muss, wie Irene immer mehr verzweifelt. Höhepunkt ist dann der Tag, da sie endlich aufhört, den Schwindel mitzumachen und in die Kamera sagt, um was für einen Lug und Trug es sich handelt – wissend, dass sie danach nicht nur ihren Job los ist und mit der Rache des Kings zu rechnen hat. Man darf sich ruhig auch an Bradburys „Fahrenheit 451“ erinnert fühlen.
Wenn sich die Leute durchsetzen, die da mit Inbrunst „Lügenpresse“ brüllen, wird es keine andere oder bessere Presse geben. Dann wird es gar keine freie Presse mehr geben. Und das einzige Warninstrument der Demokratie wird verschwinden. Bradbury hat es ja in seinem Roman bis zum Verbot aller Bücher getrieben – da waren die Bücherverbrennungen der Nazis noch relativ frisch in Erinnerung.
Aber das Reich des King ist ganz ähnlich angelegt. Und William Martin ist wohl nicht ganz zufällig völlig desillusioniert und pessimistisch, sieht auch jene durchaus unheiligen Allianzen, die die kleinen, machtgeilen Männer schließen, wenn sie erst mal die Macht in Händen halten. Und er sieht, wie sie systematisch daran gehen, auch die stabilisierenden Systeme der Gegenwart zu demolieren. Es ist also auch kein Zufall, dass die Zerstörung der EU beiläufig mit thematisiert wird. Martin hat sich also aufs Schlimmste eingerichtet und ist am Ende nur Beobachter der Tragödie. Ein durchaus bekannter Vorgang, wenn die Zerstörer erst einmal das Klima eines Landes zermürben: Viel zu viele geben auf, verlieren die Hoffnung und ziehen sich auf die Position „Ich kann ja doch nichts ändern“ zurück.
Und dann werden sie von den wilden Kampagnen der Machtgierigen erst recht überrollt, werden zur Spielmasse.
Der ganze Titel lautet übrigens „Wer die Wahrheit sagt … braucht ein verdammt schnelles Pferd“. Der Spruch wird Konfuzius zugeschrieben. Da haben sich die machtgierigen Prinzen und Kaiser in China nicht wirklich von den kleinen Alleinherrschern Europas unterschieden: Wer ihnen die Wahrheit ins Gesicht sagte, musste damit rechnen, postwendend ins Jenseits befördert zu werden.
Andererseits ist es schon weit gekommen, wenn Journalisten mit solcher Rache rechnen müssen, wenn sie den Mächtigen auf die Füße treten. Und wenn sie dann allein dastehen in einer Welt, in der alle ihre Köpfe einziehen aus Angst, aufzufallen. Das hatten wir alles schon mal. Aber es arbeiten einige Leute daran, dass das alles wieder kommt.
Flucht, Armut und eine alte, unabgegoltene Schuld
Dieter Moselt erzählt eine kleine Familiengeschichte von Flucht, Neubeginn und dem späten Wunsch, Gerechtigkeit zu schaffen
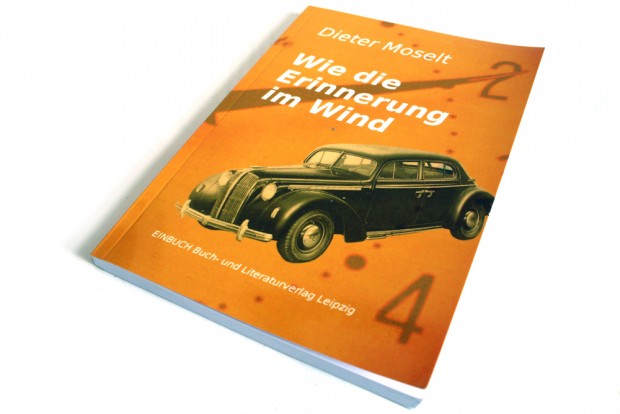
Dieter Moselt: Wie die Erinnerung im Wind. Foto: Ralf Julke
Es ist wieder Zeit für Fluchtgeschichten. Auch ganz alte. Denn viele Deutsche haben augenscheinlich völlig vergessen, wie das ist, wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen und am Ankunftsort unterwünscht sind und schikaniert werden. Auch Dieter Moselt kann so eine Geschichte erzählen. Zumindest ersatzweise. Denn als seine Familie aus dem Warthegau floh, war er selbst noch viel zu klein, gerade zwei Jahre alt. Warthegau? Ja, schreibt er so.
Dabei ist dieses Gebiet rechts und links der Warthe (polnisch: Warta) altes polnisches Siedlungsgebiet. Aber gerade deshalb wechselte es im Lauf der Jahrhunderte immer wieder den Besitzer. Mal waren es die Preußen, die sich hier breit machten, mal das zaristische Russland. Dann wieder war es für kurze Zeit wieder Teil des neu gegründeten Polen, bis 1939 die Deutschen einmarschierten und das Gebiet zwischen Schlesien und Pommern zum „Reichsgau Wartheland“ machten – mit Gauleiter und Umsiedlungspolitik und allen anderen Schikanen, die die Nazis für die einverleibten Gebiete im Osten auf der Liste hatten.
Dabei konnten sie auch auf über 300.000 Deutsche setzen, die hier bei einer Gesamtbevölkerung von 4,5 Millionen Menschen lebten. Und ein Teil kollaborierte eifrig mit den neuen „Herren“, andere versuchten, sich aus den Dingen herauszuhalten. In der Geschichte, die Moselt erzählt, geht der Riss mitten durch die Familie: Während der Vater Stans versucht, ein einigermaßen anständiges Leben zu führen, ist dessen Bruder zum stahlharten Nazi geworden und hat auch die polnischen Widerstandskämpfer im Ort verraten. Logisch, dass die Polen nach der Befreiung durch die Sowjetarmee auf Rache sinnen und den Verräter suchen. Aber wie das so ist mit Nazis: Wenn es um die Abrechnung geht, sind sie immer verschwunden, haben sich frühzeitig in den Westen abgesetzt (so wie auch Gauleiter Arthur Greiser) und sind damit nicht mehr erreichbar. Was für Stans Vater zum Problem wird, als die Polen den Namen des Schuldigen haben wollen – aber eines Schuldigen, den sie noch bestrafen können. Was in der Dramatik dieser Zeit natürlich wieder bedeutet, dass zwei Unschuldige zum Opfer werden und Stans Familie nicht nur das Wissen um dieses Versagen mit sich nimmt, als ihr endlich die Flucht Richtung Breslau gelingt, sondern auch den nun elternlosen Josef, der für Stan zum kleinen Bruder wird.
Eindrucksvoll erzählt Moselt, wie es der kleinen Familie nach ihrer Ankunft gelingt, sich anfangs in ärmlichsten Verhältnissen einzurichten und sich nach und nach ein klein wenig Sicherheit und Wohlstand zu erarbeiten. Die Schwierigkeiten, in einem kleinen niedersächsischen Dorf Fuß zu fassen, werden erzählt, die Probleme in der neuen Schule in der großen Stadt, wo die Kinder wieder Außenseiter sind. Die Einheimischen begegneten Flüchtlingen aus dem Osten im Grunde mit denselben Vorurteilen und Bosheiten, mit denen später auf jede andere Art von Einwanderung auch reagiert wurde. Das wiederholt sich augenscheinlich in immer neuen Schleifen und es dauert lange, bis die Gräben geschlossen sind und die Neuankömmlinge selbst zum Teil einer Gesellschaft geworden sind, die sich verändert hat, da und dort auch ein Stück weit offener geworden ist für das Fremde, dem die beiden Jungen bei einer kleinen Liebeserfahrung in den Ferien begegnen. Doch die geht am Ende tragisch aus.
Ganz verschwunden sind die Erinnerungen an die dunklen Vorfälle in der Kindheit nicht. Wenn es drauf ankam, ging der große „Bruder“ für den Kleinen auch mal zum Äußersten – auch wenn er nach dem Vorfall mit dem pädophilen Lehrer nicht wirklich weiß, ob er da nun Schuld auf sich geladen hat. Und wie viel. Denn auch wenn der Vater in der Geschichte oft als schwach und nicht standhaft erscheint, können die beiden Jungen am Ende nur feststellen, dass er wohl doch anders war als die meisten Männer in dieser Generation. Geschlagen hat er die Jungen nie.
Und so steckt auch dieser Stan, der bewusst einen anderen Namen angenommen hat, um nicht mit seinem Nazi-Onkel verwechselt zu werden, nicht voller Rachegefühle, auch wenn er sich am Ende – nach einem langen Gespräch mit Josef – auf die Suche nach dem Schuldigen an Josefs Lebenstragödie aufmacht, nicht ahnend, dass er im fernen Namibia einem alten Mann begegnen würde, der nicht ein bisschen bereit ist zu bereuen, was er getan hat, und der immer noch von der Überlegenheit der weißen Rasse redet und scheinbar so eine Art Wohltäter der ganzen Region geworden ist. Die verbale Begegnung wird regelrecht zur Niederlage, weil Stans Vorwürfe an der eisigen Wand der Selbstgerechtigkeit abprallen. Ein Moment, das einen doch erstaunlich an die moderne Arroganz der ewigen Chauvinisten erinnert: Sie leben in einer Welt, in der Schwäche, Verständnis, Menschlichkeit keinen Platz haben. Verächtlich schauen sie auf die scheinbar so weichen und willensschwachen „Gutmenschen“ herab (haben wir schon geschrieben, dass das Wort aus dem Nazi-Wortschatz stammt?), genauso, wie sie es heute wieder in sozialen Netzwerken und auf arroganten Demonstrationen tun. Für das Schicksal ihrer Mitmenschen interessieren sich diese Leute nicht, auch Stans eisiger Onkel tut es nicht. Er reagiert nicht mal, als sein Neffe ihm entgegen wirft: „Doch eines Tages holt dich der Teufel!“
Dafür stellt er sich hochnäsig zum Foto auf, dicht am zweitgrößten Canyon der Welt, labert einfach weiter und versucht dem Neffen klar zu machen, dass Hitler nur die Schweiz hätte erobern müssen, dann hätte er den Krieg gewonnen. Und dann stürzt er in einem Moment der Unachtsamkeit über die Felskante, kann noch geborgen werden. Aber seine letzten Worte sind genau das, was Stan nicht erwartet hatte. Denn dieser eingebildete Onkel zeigt mit dem Finger auf ihn und beschuldigt ihn, ihn über den Felsen gestürzt zu haben.
Dieter Moselt lässt die Sache noch einmal glimpflich ausgehen. Auch mit jener kleinen notwendigen Ent-Täuschung, die dem Wohltäter Namibias am Ende auch diesen Glorienschein noch entzieht. Aber schon der nächste Fetzen Zeitung, der Stan vor die Füße wedelt, zeigt ihm, dass die Welt voller falscher Onkel ist, überheblicher Mistkerle ohne Herz und Verstand, denen es trotzdem gelingt, sich als Wohltäter und Retter aufzuspielen und andere Menschen wie Marionetten an ihren Fäden tanzen zu lassen. Da schrumpft auch der Trost, einer brandgefährlichen Situation gerade so entkommen zu sein, schnell auf Erbsengröße zusammen, die Freude, eben noch hilfreichen Menschen begegnet zu sein, erstarrt in der Wahrnehmung, dass die von eiskalten Männern entfesselten Kriege nie aufhören. Und das ist auch möglich, weil die falschen Werte regieren: „Und auf der Werteskala kommt die Liebe weit nach der Coca Cola“.
An der Stelle endet die Geschichte, die wie eine Erinnerung daherkommt, eine der vielen Erinnerungsgeschichten, die auch die Kinder der einstigen Flüchtlinge mittlerweile schreiben, um ein Stück ihrer Familienüberlieferungen zu bewahren. Geschichte im Kleinen, oft stark reduziert aufs persönliche Schicksal. Dass aber am Anfang die eisigen Täter waren, die alle Tragik erst in Gang gebracht haben, steht nicht immer da. Hier wird es thematisiert, und auch wenn der alte Schlager „Sag mir, wo die Blumen sind“ anklingt, weiß der Erzähler in diesem Fall, wer es getan hat. Nur dass sich die Begegnung dann wie eine Niederlage anfühlt – wieder mal. Weil man mit dem Wunsch nach Menschlichkeit und Gerechtigkeit die eisige Schale der Täter nicht zu durchdringen vermag.
Dieter Moselt Wie die Erinnerung im Wind, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2016, 12,90 Euro.
Ein Jahr auf Vogelpirsch im Leinetal
Hauke Meyers lange Suche nach dem Grund für die Unruhe und nach der eigentlichen Schönheit des Planeten Meyer
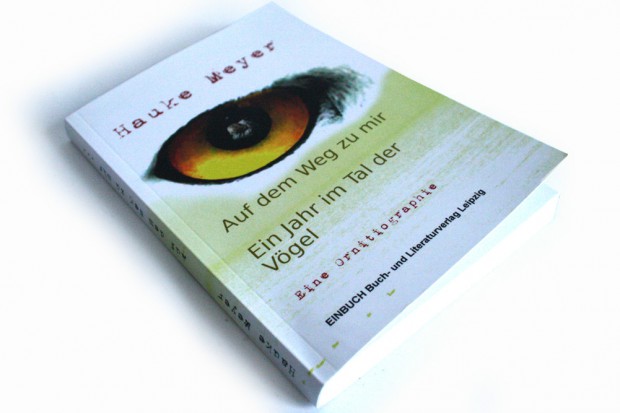
Hauke Meyer: Auf dem Weg zu mir. Foto: Ralf Julke
Was passiert eigentlich, wenn ein Mann mitten im Leben, so kurz vor der 40, ins Grübeln gerät über sein Leben, die Welt, die Politik und den ganzen Rest? Passiert ja nicht allzu häufig. Viele haben in dem Alter ihren Kopf schon ausgeschaltet, spulen nur noch ab, plappern nach, funktionieren. Und kommen auch nicht auf die Idee, dass etwas falsch sein könnte an ihrem Leben.
Wenigstens nachdenken wollte Hauke Meyer mal über den ganzen Kram. Die Unruhe steckte in ihm. Er hatte seinen Job als Sozialpädagoge, der jungen Menschen nach ihrer katastrophalen Bildungskarriere erklärte, wie man wieder „zurück ins System“ kommt und sich dabei an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Man kann ihn sich schon vorstellen, den „besten Sozialpädagogen der Republik“, wie er die Entmutigten, Lustlosen, Frustrierten bei ihrem Stolz packt, ihrer angelernten Dünkelhaftigkeit und ihrer „Ist doch eh egal“-Stimmung, herausfordert, nervt und ärgert und gerade mit seiner Schnoddrigkeit dazu bringt, wieder ein bisschen Laufen zu lernen.
Er lebt noch immer in Einbeck, der Stadt, wo er aufgewachsen ist. Früher war er mal Punk, auch irgendwie links. Ein echtes Kind der 1980er, die seine Kindheit und Jugend geprägt haben. Seine Schulzeit war überschattet von der Dauerregentschaft Helmut Kohls. Es war die Zeit, als die Engländer die beste Musik der Welt machten. Die Scheiben hat er noch heute. Und die Songs dieser Jugend schleichen sich auch in dieses Buch, das ein wenig von seinem großen Faible erzählt: der Vogelbeobachtung. Birdwatching. Birder nennt er sich und weiß sich im Leinetal in bester Gesellschaft mit Gleichgesinnten, die ebenso beharrlich losziehen, um die Vogelwelt zu beobachten. Eine Welt neben unserer Welt. Da spotten selbst Haukes Freunde: Zwölf Vogelarten werde er wohl beobachten. Viel mehr kennt ja der unaufmerksame Laie nicht.
Aber so ganz zufällig ist Hauke Meyer nicht zu seinem Hobby gekommen. Da haben ihn ein paar Großväter angefixt, wie das oft so ist. Manchmal merkt man erst spät, wie wichtig die alten Knaben waren und wie ihre Worte nachleben in uns. Vielleicht sogar absichtslos erzählt, gezeigt. Schau hin. Präg es dir ein. Vögel sind nicht nur Vögel. Der Reichtum liegt im Detail. Und nur wer genau hinschaut, merkt, wie reich unsere Welt ist. Noch.
Das ist Hauke Meyer sehr bewusst, auch wenn die letzten Jahre für den raubeinigen Familienvater doch sehr ernüchternd waren. Das erspart er dem Leser gar nicht. Und es ist irgendwie vertraut. Denn wer in seiner Jugend Typen wie Hans-Dietrich Genscher, Helmut Schmidt und Gregor Gysi erlebt hat und mit dem vergleicht, was heute auf der politischen Bühne passiert, der kommt schon ins Grübeln. Auch über die Republik, die irgendwie in seltsames Fahrwasser geraten ist. Denn es ist schon eigenartig, wenn 2014 eine Stimmung im Land ist, in der ein Helmut Schmidt mit Sicherheit die Wahl zum Bundeskanzler gewonnen hätte.
Aber weder die SPD ist noch, was sie mal war, weder haben die Grünen oder die Linken noch die Glut der frühen Jahre.
Das kann täuschen. Meyer schreibt ja einfach drauf los. Wenn ein Thema ihn packt, versucht er es so klar wie möglich zu formulieren, bevor er weitermacht mit dem Aufzählen von Vögeln, die er in den Poldern an der Leine beobachtet hat. Denn um in diesem Jahr 2014 seinen Lebensfaden zu finden, hat er sich vorgenommen, wenigstens 200 Vogelarten zu beobachten. Das zwingt zum Innehalten, zum Aufmerksamsein, zum Rausgehen sowieso, auch wenn er Dutzende allein schon im Garten vor seinem Haus am Wald beobachten kann.
Er versucht, zeitnah alles niederzuschreiben, wissend, dass auch das Leben dazwischen kommen kann. Und zum Jahresende kommt es heftig dazwischen. Da wird er dann auch gezwungen, über das Elementarste nachzudenken. Da werden auch die Töne etwas weniger ruppig und hemdsärmelig.
Der Leser merkt es schnell: So leicht auszuhalten ist dieser Hauke Meyer nicht. Das gibt er auch gern zu. Seiten füllt er mit Beschreibungen seiner Unzufriedenheit, seiner Selbstzweifel – immer wieder konterkariert mit der Betonung, dass er doch nur ein ganz gewöhnlicher, mittelmäßiger Mensch sei, der die Dinge, die er sich wünscht, auch eigentlich hat. Aber woher kommt dann die Unruhe?
Am Ende scheint sich das zu klären. Und das ist schon etwas, was den meisten Mittelmäßigen im Land in der Regel früh verloren geht. Denn die eigentliche Triebkraft im Leben ist die Neugier auf immer Neues, auf die Erweiterung des eigenen Horizontes. Das hält lebendig. Wer also dachte, dass dieser Bursche, der deutlich betont, dass er ganz bestimmt nicht konservativ, eher ein echter Liberaler sei mittlerweile, nun irgendetwas übrig hätte für die neuen Renitenten von der AfD und ihrer Dresdener Begleitmusik, der irrt. Für diesen Haufen der Verlaufenen hat er überhaupt kein Verständnis.
Man merkt, dass seine Unzufriedenheit mit Grün und Rot und Rosarot woanders herkommt – auch aus einer gewaltigen Enttäuschung, die er wahrscheinlich mit Millionen anderen in diesem Land teilt. Eine Enttäuschung, die er so nebenbei auch noch in einer Oi-Punk-Band auslebt. Ein Liedtext für die Band bringt sein Hadern auf den Punkt. Denn wenn das Liberalsein in Egoismus umkippt, dann werden auch die spätrevolutionären Punk-Posen eher aggressiv als sinnstiftend: „Ich leb‘ mein Leben nach meinen Regeln und weißt du was, das Leben gibt mir Recht – ich schulde keinem etwas, hör nur auf mich selbst.“
Dabei lebt sein Buch von genau diesem Widerspruch, dass er eigentlich Leute, die sich nicht an Regeln halten, gar nicht mag. Leute, die nur im Schwarm flattern aber auch nicht. Womit er ja den Grundwiderspruch einer Zeit benennt, die die größten Egoisten feiert, im Wesen aber an einer zunehmenden Kälte und Oberflächlichkeit leidet. Manchmal gehen die Argumente mit ihm durch und manchmal passen sie auch nicht zusammen. Aber im Nachwort betont er auch, dass er lieber nichts redigiert hat, weil auch das zu seinem Naturell gehöre. Der Widerspruch muss raus.
Aber er findet dann doch etwas Wesentliches. Auch eine Variante des scheinbar zelebrierten Egoismus, die eigentlich etwas anderes ist, nämlich die Fähigkeit, einen eigenen Weg zu wählen und auch dazu zu stehen. Sich eben nicht einfach von anderen dirigieren und irgendwohin schubsen zu lassen. Auch das gibt genug Konflikte und Reibungsstellen – mit Eltern, Lehrern, Kollegen. Wer kennt das nicht? Aber mal ehrlich: Ein eigenes Leben wird nur draus, wenn man auch dazu steht. Und zwar nicht nur mit renitenter Punk-Pose, sondern so: „Liebe und Hingabe im Sinne der Sache – alles andere ist Illusion.“
Das haut er seinen Freunden in der Stammkneipe dann auch noch einmal um die Ohren. Und auch das hat mit seiner Beobachtung der Vögel zu tun. Denn gerade durch das Kommen und Gehen, das Dableiben und Ausbleiben all dieser Gefiederten, von denen viele auf der Roten Liste stehen, wurde ihm auch bewusst, mit welcher Beharrlichkeit die Vogelarten versuchen, ihr Überleben zu sichern: „Vögel jammern nicht. Vögel sind.“
Und das ist für manches Jahr schon eine ermutigende Erkenntnis, wenn man sagen kann: Ich bin.
Denn dazu muss man ja erst einmal ausgezogen sein auf der Suche nach diesem „Wer bin ich überhaupt?“ Und: „Was bin ich?“
Da geht dieser Hauke Meyer aus Südniedersachsen auch manchmal sehr ruppig mit sich und seinen Liebsten um. Aber seine beiden Wintergoldhähnchen scheinen ihn doch so nehmen zu wollen, wie er ist. Und wenn man so recht nachdenkt: So ein ruppiger Bursche, der auch mal dreckige Vergleiche wählt, ist einem doch irgendwie wesentlich sympathischer als all die glattgeleckten „Ich bin irgendwas“, bei denen man nicht mal auf die Idee käme, es könnten komische Vögel sein.
Hauke Meyer Auf dem Weg zu mir, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 13,40 Euro.
Ein Krimi auf Abwegen in die hessische Provinz
Ein sauberer Todesfall, seltsame Affären und eine Heldin ohne Skrupel

Martin Lenz: Kein Sekt für Ilona. Foto: Ralf Julke
Es ist ja nicht so einfach mit dem Krimischreiben. In welche Rolle schlüpft man nun? In die der Ermittler? Die der Täter? Oder die einer verwirrten Öffentlichkeit? Es gibt Autoren, die können sich nicht entscheiden und versuchen dann – wie Martin Lenz – zwei Geschichten in einer zu erzählen. Oder drei. Denn Verbrechen sind ja alles andere als das, was der moderne Mediennutzer meist glaubt: eindeutige Ereignisse.
Was übrigens auch ein Grund dafür ist, dass das Krimi-Genre seit ein paar Jahren blüht und gar nicht genug Krimis geschrieben werden können, um das Leserinteresse zu befriedigen. Immer neue Spielformen entstehen, immer tiefer tauchen die Autoren nicht nur ins mühselige Handwerk der Kriminalisten ein, sondern auch in die psychologischen und sozialen Abgründe der modernen Gesellschaften. Kein Genre hält der Gesellschaft so den Spiegel vor, zeigt die schmutzigen Ecken genauso wie die moralischen Abgründe der feinen Gesellschaft.
Oder – wie Lenz in diesem Fall – dem Leser ein paar wirklich kaputte Gestalten des heutigen Frankfurt. Im Mittelpunkt – auch wenn das anfangs so scheint – nicht das emsige Ermittler-Duo Ruppert und Horn, das sich nun mit dem etwas unerwarteten Tod eines frisch pensionierten Ressortleiters des Hessischen Rundfunks beschäftigen muss. Ein Fall, der erst einmal ganz einfach und sauber wirkt. Und er führt auch nicht in die korrupte Welt des deutschen Rundfunks, von Auftragsschiebereien oder politischer Einflussnahme. Schade, sagt sich das immer wache Gemüt des politisch geschulten Lesers.
Erst recht, wenn so nebenbei auch noch ein Protagonist überall verkündet, er werde ein Buch über echte kriminelle Machenschaften veröffentlichen, die die Republik erschüttern werden. Davon erfährt man später auch etwas.
Aber Martin Lenz ist einer, der eher mit dem analytischen deutschen Roman der 1950er und 1960er Jahre aufgewachsen ist. Das hatte damals Stil. Man denke nur an Franz Josef Degenhardt, der in seinen sozialkritischen Romanen die von Stereotypen geprägte Gesellschaft jener Zeit untersuchte, die heute so gern als „Wirtschaftswunder“ beschrieben wird. Seine Figuren führte er aus der Distanz und ließ seine Leser immer spüren, dass er von „diesem da“ sprach – einer dieser geplagten zeitgenössischen Gestalten, die sich verzweifelt bemühte, ihr eigenes Leben zu leben, und doch nicht aus ihrer Rolle, ihrer Stellung und der ihr zugewiesenen Position im sozialen Gefüge kam.
Ein paar Jahrzehnte durfte man sich durchaus der Illusion hingeben, das einstige Schichten- und Kastengefüge der alten Bundesrepublik sei verschwunden, aufgelöst in einem großen Brei moderner Gleichmacherei. Aber das alte Schichtendenken hat sich nur maskiert und zeigt sich – in Städten wie Frankfurt wohl noch viel deutlicher als anderswo – wieder in alter elitärer Arroganz, aber auch in einem seit Jahren wieder radikalisierten Karriere-Denken. Dass derzeit in deutschen Provinzen die blanke Angst umgeht, das hat mit diesem Elitedenken zu tun, denn bis in die letzten Verästelungen der Gesellschaft hinein hat sich die Panik verbreitet, dass jeder, der es nicht schafft, sich „nach oben“ durchzuboxen, auf der Strecke bleibt, finanziell nie auf trockenes Land kommt und auch sonst nur noch das Gefühl haben darf, zu den Verlierern dieses Rennens zu gehören.
Die Welt, die Martin Lenz schildert, ist so eine vom Karrieredenken besessene Welt. Und die zentrale Figur Ilona, die beim Hessischen Rundfunk schon ein Stück Karriere gemacht hat, ist ein Ausbund dieses Denkens, was dem Leser erst so langsam deutlich wird. Man will sich ja gern identifizieren mit der Hauptfigur. Gerade weil sie augenscheinlich heftig zu kämpfen hat nach der Entdeckung des Toten, etwa mit ihrer Herkunft in einem kleinen Kaff in der Nähe von Frankfurt, in dem die Gemüter kochen und wo die Dagebliebenen sich die Mäuler zerfetzen, nachdem Ilona sich auch noch im Fernsehen geoutet hat. Was für eine „Schande“ für ihren Vater, der da leben muss, in dieser kleinen Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten, wo jeder jeden kennt und jeder glaubt, über andere urteilen zu dürfen. Nirgendwo ist der Anpassungsdruck so groß wie in der deutschen Provinz. Und die Romane, die sich mit dieser piefigen und beklemmenden Welt beschäftigen, sind mittlerweile Legion.
Ilona stellt sich dem zwar und macht dabei einige auch für sie überraschende Entdeckungen. Aber sie ist in diesem Buch nicht die einzige, die für den Ausbruch aus dieser Piefigkeit einen teuren charakterlichen Preis gezahlt hat. Das merkt der Leser spätestens, wenn der Autor ihre Gedanken über ihre Lebensgefährtin, ihre Kollegen, „Freunde“ und die Menschen wiedergibt, die jetzt im Leben ihres Vaters auf einmal eine Rolle spielen – Italiener und Polen.
Hoppla, sagt man sich so beim Lesen, da hat man ihn auf frischer Tat ertappt: den arroganten, allseits waltenden ganz gemeinen und normalen deutschen Alltagsrassismus, der vor allem eines ist: tiefste Verunsicherung in der eigenen Rolle.
Das wird spätestens an der Stelle deutlich, als Ilonas Vater mit einem Frankfurter Taxifahrer sein Feldbusch-Abenteuer hat, eine kleine Anekdote eigentlich, in der Lenz die Suche des Mannes nach dem richtigen Umgang mit der zusehends komplizierter gewordenen Welt deutlich macht. Immerhin musste er eben schon das Outing seiner Tochter verdauen. Jetzt versucht er den Fahrer, der dann auch noch verrät, dass er Wurzeln in Marokko hat, mit der heute so typischen deutschen „Lockerheit“ zu nehmen – doch die ganze Fahrt über ist er von der Panik besessen, nun ja nicht irgendwelche rassistischen Vorurteile gucken zu lassen. Es ist wohl eine der schönsten Stellen, in der die moderne deutsche Schizophrenie deutlich wird: Im persönlichen Umgang ist Rassismus (zumindest für die meisten Bürger) völlig tabuisiert. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft aber mit lauter rassistischen Vorurteilen getränkt, die auch fest eingebaut sind in unser alltägliches Karriere- und Elite-Denken.
Von einem wirklich selbstverständlichen und vorurteilsfreien Umgang mit Menschen aus anderen Ländern sind wir meilenweit entfernt. Und im kleinen Spielfeld Unterpfeffersheim wird deutlich, wie das fortlebt und wirkt – auch dann, wenn eigentlich Italiener und Polen längst diejenigen sind, die die Wirtschaft in diesem Nest am Laufen halten. Wenn auch – wie in diesem Fall – mit nicht ganz durchsichtigen Geschäften. In einer Gesellschaft, die so wenig bei sich ist, reduziert sich die gepflegte Gemeinsamkeit dann nur noch auf zwei Dinge: auf die berufliche Karriere und aufs Geld (und den Besitz). Das ist dann die bundesdeutsche Gesellschaft in nuce.
Und man merkt, dass sich der 1933 in Halle an der Saale geborene Autor, der nach seinem Studium 1957 in den Westen wechselte, diesen etwas kritischen und leicht verstörten Blick auf diese Gesellschaft bewahrt hat, auch wenn er ein paar Jahre im hessischen Schuldienst tätig war. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Und nun im höheren Alter verarbeitet er seine skeptische Sicht auf die hessische Provinz in Büchern, die irgendwie die Anlage zum Krimi haben, aber noch viel stärker zur Analyse der Verwerfungen in einer Gesellschaft neigen, die ihre eigentlichen Probleme gern versteckt und in der sich Typen wie Ilona als die Gewinner sehen, weil sie sich sicher sind, dass Skrupel bei der Karriere nur stören. Sehr bildhaft durchgespielt im spürbaren Bruch ihrer Beziehung mit Jennifer, die das Zerstören von Ameisenhügeln und das qualvolle Töten von Katzen und Fröschen („So ist nun mal die Welt.“) überhaupt nicht vertragen kann.
Und so nebenbei wird auch die ganze verkopfte Diskussion des Westens über ein kaputtes Sex- und Liebesleben sichtbar, das sichtlich eine Menge mit dieser Besessenheit von Karriere und Erfolg zu tun hat, mit dem ständigen pekuniären Blick auf Partnerschaft, Sicherheit und Selbstdarstellung. Da wird in elitären Runden über „Treue“ gefaselt – aber im realen Leben traut niemand dem anderen. Eine Atmosphäre aus Neid, Missgunst und Vorurteilen entsteht. Ilona lebt mittendrin.
Man versteht Kommissar Ruppert sehr gut, dass er gerade diese Ilona nur zu gern zur Hauptverdächtigen in seinem Fall gemacht hätte. Und es deutet auch einiges darauf hin, dass Ilona am meisten profitiert in einem Gespinst von Andeutungen und Halbwahrheiten, in dem auch ihre Schwangerschaft eine Rolle spielt, von der bis zum Schluss nicht klar ist, ob die tatsächlich existiert.
Noch etwas verwickelter wird die ganze Geschichte, weil auch noch das Homosexuellen-Milieu eine Rolle spielt. Was dann die Lösung des Falls etwas enttäuschend macht. Aber das gehört wohl auch zur Wirklichkeit: Zum Täter werden am Ende eher die ratlosen Gestalten vom Rand der Gesellschaft, während die Cleverles, die sich in die richtige Position manövriert haben, den eigentlichen Reibach einstreichen und Ermittler wie Ruppert und Hold eher mit dem Gefühl zurücklassen, dass sie wohl doch irgendetwas übersehen haben müssen. Auch Ruppert sagt am Ende „So ist das Leben.“ Aber er sagt es völlig anders als der gefühllose Schwager, der Jennifer so entsetzt hat. Es steckt nicht dieses rücksichtslose „Fressen und Gefressenwerden drin“ (hinter dem sich ein gut Teil des bürgerlichen Sozialdarwinismus versteckt), sondern die freundliche Botschaft des älteren Ermittlers, dass man ja „eigentlich einen Fahndungserfolg feiern“ könnte. Aber nur eigentlich. Denn da, wo Hilde Horn gern weiterermittelt hätte, ist die unsichtbare Grenzlinie gezogen. Wenn der Täter gefunden ist, darf auch die Frage nicht weiterverfolgt werden: Und wer hat eigentlich die Spielfiguren geführt?
Martin Lenz Kein Sekt für Ilona, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 13,90 Euro.
Grün oder Wer hat da eigentlich seine Stimme verloren?
Ein Buch über das Schweigen der Gefühle und die Grausamkeit der Farbe Grau
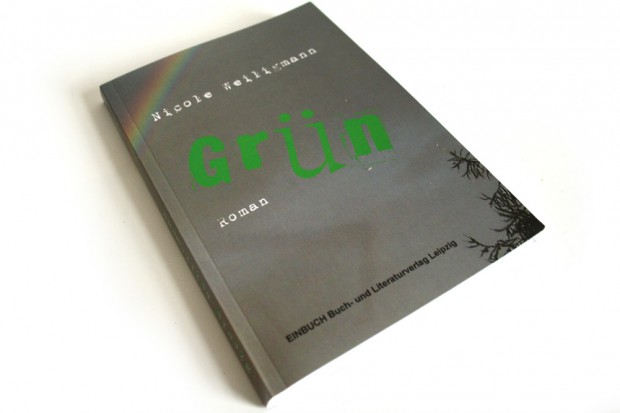
Nicole Weiligmann: Grün. Foto: Ralf Julke
Auch wenn groß “Grün” auf dem Umschlag steht, ist es kein Buch über eine farbenfrohe politische Bewegung. Aber um Farbe geht es tatsächlich. Und darum, wie wichtig Farbe in unserem Leben ist und wie sehr unsere Gefühle die Welt in Farben tauchen. Oder in Grau, die Nicht-Farbe unserer Alpträume. Das kennt jeder, wie die Welt ihre Farbe verliert, wenn wir seelisch in Not sind.
Dazu hat der Einbuch-Verlag schon einige Bücher veröffentlicht, Debüt-Geschichten in der Regel, Manuskripte, die andere und größere Verlage schon lange nicht mehr bringen, weil sie nicht in die üblichen Erzählraster passen. Dass auf über 90 Prozent dessen, was sich auf den Präsentiertischen der Buchhandlungen stapelt, der Stempel „Verlogen und eingebildet“ stehen könnte, ist vielen Viellesern vielleicht noch unterschwellig bewusst. Sie kaufen das Zeug trotzdem, lesen die immer gleiche sahnige Brühe in immer neuen Varianten (auch den professoralen, die dann in Deutschland die Buchpreise bekommen) und haben vielleicht noch vage das Gefühl, dass eigentlich das Wichtigste unerzählt bleibt, das Leben, wie es die meisten selbst erleben. In aller Rauheit, Verworrenheit und Schärfe.
Gibt es aber in Deutschland überhaupt noch Spannendes zu erzählen?
Wenn sich Autoren trauen zu erzählen, dann schon. Jedes Leben ist ein Drama – auch wenn die meisten Leute alles dafür tun, diesem Drama zu entkommen, indem sie sich in eine Welt von Phrasen, Rüschen und Lügen einspinnen.
Dabei sind auch die Dramen der Familie noch genauso präsent wie in fernsehlosen Vorzeiten. Väter verzweifeln an ihren Rollen, hadern mit alten Bildern vom Starksein, Mütter trauern den verpassten Chancen ihrer goldenen Jugend nach, fühlen sich unverwirklicht und von Haushalt und Kindern unterdrückt, Jugendliche rebellieren gegen den heimischen Ordnungs- und Kontrollwahn und sind trotzdem ratlos der eigenen Zukunft gegenüber. Der Alltag hält die Rituale am Laufen, in die sich alle zwängen, auch wenn sie – für sich allein – fluchen: Was für eine beschissene Familie.
Und dabei war doch am Anfang alles so schön, so hochzeitlich und lebensfroh. Auch bei Nicole Weiligmann ist das so: Für Birgit und Joachim war ihr Leben anfangs auch mal eine Rebellion gegen strenge Eltern, die nicht loslassen wollten und die falschen Erwartungen hatten. Und noch immer haben. Wer das in seiner kleinen, so mühsam aufgebauten Partnerschaft erlebt, der weiß, was das für Dramen in die Beziehung bringt. Das glimmt vor sich hin und jeder Besuch bei den Alten wird zu einer Tragödie. Irgendwann lässt man das dann.
Familie Götz lebt irgendwo in der Provinz. Wo, ist eigentlich egal. Wenn man nicht wüsste, dass Nicole Weiligmann in Münster geboren wurde und in München lebt, dann könnte man sich die Geschichte in Dessau genauso gut vorstellen wie in Erfurt, Neubrandenburg oder Hoyerswerda. Joachim ist Maler (und sucht seinen Ausgleich im Fitnesscenter), Birgit arbeitet im Supermarkt, Sohn Jonas geht noch zur Schule, hat aber keine Lust mehr dazu, Tochter Sofia hat (gegen den Willen der Eltern) Abitur gemacht und studiert Jura, weit weg natürlich in einer anderen Stadt. Und dann ist da noch Marie, das Nesthäkchen, der Nachkömmling, als Joachim und Birgit eigentlich keine Kinder mehr haben wollten. Damit hadern die beiden. Und lassen es das Kind auch spüren. Es ist jene grauenvolle Mischung aus Liebe und Verzweiflung, die viele Kinder kennenlernen, wenn ihre eigenen Eltern noch immer nicht erwachsen sind.
Und das sind weder Joachim noch Birgit, auch wenn sie oft genug dasitzen und „völlig fertig“ sind mit sich und ihrem Leben. Und wenn ein Kind dann das Falsche sagt, gibt’s kurzerhand ein gebrülltes „Halt’s Maul“. Oder Joachim schlägt gleich zu.
Und als es ihm wieder einmal passiert, hat das Folgen: Marie verliert ihre Stimme. Fortan schweigt sie und sucht ihren Trost draußen im Park bei den Bäumen. Und sie ist die Erste, die entdeckt, dass die Bäume im Frühjahr nicht grünen wollen. Die Blumen blühen nicht. Die Vögel singen nicht. Und so langsam kommt eine ganz seltsame Stimmung auf in dem Gebiet, in dem in diesem Jahr der Frühling ausbleibt. Und ziemlich bald ist klar: Die kleine Stadt mit der Familie Götz und der stummen Marie ist mittendrin in diesem Gebiet, das von den Politikern und Amtswaltern ganz schnell mit Argusaugen betrachtet wird. Und ziemlich schnell machen sie eine Sperrzone draus, riegeln es ab und planen die Vernichtung des gemutmaßten Krankheitskeims, der die Natur am Erwachen hindert.
Logisch, dass das ziemlich schnell bürgerkriegsähnliche Zustände nach sich zieht. Man fühlt sich an die politischen Eskapaden der Gegenwart erinnert. Aber um die geht es eigentlich nicht, auch wenn Birgit und Joachim durch die Umstände gezwungen werden, über sich selbst, ihre Arbeit und ihr Verhältnis zueinander neu nachzudenken. Erst recht, als auch Jonas beginnt aufzubegehren. Gespickt ist der Text mit vielen kleinen Dialogen, bei denen man anfangs nicht so recht weiß, wer sich da eigentlich unterhält über das Glücklichsein, das Wichtigsein, das Bösesein, die Einsamkeit und die Angst. Am Ende weiß man es dann.
Denn der Kern der Geschichte ist ja nicht – wie der Buchdeckel suggeriert – eine „fantastische Utopie“, auch nicht die ergraute, farblose Welt, die eigentlich das beste Zeug hätte, in eine dieser quälenden Dystopien von J. G. Ballard abzugleiten. Der Kern ist tatsächlich diese kleine Familie, die eigentlich festgefahren scheint in ihren Ängsten, Überforderungen, Wortlosigkeiten. Und da man bald spürt, dass diese Unfähigkeit, zu vertrauen und zu lieben, etwas zu tun haben muss mit der grauen Landschaft draußen, wird die Geschichte zu einem Spiel auf Hoffnung: Schaffen es die in ihrer Wortlosigkeit Eingesperrten, die Barrieren zu überwinden?
Das ist ja die eigentliche Utopie, die die meisten Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, nie erleben. Eher enden solche Dramen in Entsetzen und neuen Verletzungen, die in die nächste Generation weitergegeben werden.
Und einfach macht es die Autorin ihren Helden auch nicht. Sie verzagen, verzweifeln, haben Momente der Nachdenklichkeit, werden dann aber doch wieder mitgerissen von den Zwängen des Tages.
Eigentlich ist es erst die Ausnahmesituation, die sie zu Veränderungen zwingt, zum Innehalten und Überprüfen der eigenen Gefühle. Was die meisten Menschen in der Regel nicht tun, wenn sie glauben, fertig zu sein, will heißen: erwachsen. Was ja für Viele meist nur bedeutet, „keine Zeit“ mehr zu haben – für sich, ihre Träume, ihre Kinder, ihre Nächsten. Natürlich ist die Fabel auch ein wenig Erlösung, so, wie sich Menschen gern Erlösung wünschen aus einem festgefahrenen und schiefgelaufenen Leben. Aber Erlösung passiert nicht „von oben“. Die muss man sich schon selbst erarbeiten, wieder sehen, fühlen und verstehen lernen.
Und natürlich ist genau so etwas gemeint, wenn in der Bibel was zur Nächstenliebe steht. Man kann den Nächsten oder Übernächsten nicht lieben, wenn man sich selbst nicht versteht und achtet. Ist das nun eine christliche Geschichte? – Eigentlich nicht. Eine allzumenschliche eher, eine, die zu Herzen geht, weil man sich als Leser eigentlich mit Marie identifiziert und ahnt, warum sie nicht mehr sprechen kann. Und auch, warum sie nicht die Erste sein wird, die wieder sprechen darf. Zuerst müssen andere ihre Stimme finden. Und das ist schwer. Denn die Welt, die Nicole Weiligmann hier beschreibt, ist ja nicht so, dass das ein akzeptiertes Sprechen wäre. Es ist eine sehr vertraute Welt. Und man versteht nur zu gut, warum junge Menschen in so einer Welt nicht mehr leben möchten und fliehen. Ins eigene Zimmer, wo sie die Musik bis zum Anschlag aufdrehen, oder weit, weit weg zum Studium.
Das Dumme ist nur: Die Menschen, die so verlernt haben, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen, die würden solche Bücher nicht lesen. Höchstens die dicken Liebesromane, die auch Birgit im Bett liest, bis sie irgendwann merkt, dass diese falschen Geschichten sie eigentlich anöden.
Es gibt eine Menge Menschen, die nicht einmal mehr merken, dass es in ihrer Welt keinen Frühling mehr gibt und die Grün und Vögel und Bäume (und Eisvögel) für Quatsch halten. „Mumpitz“, wie es der graue Ebeneezer Scrooge so gern formulierte. Und sie merken auch nicht, was passiert, wenn sie keine eigene Stimme mehr haben, und was sie damit ihren Nächsten und Übernächsten antun.
In diesem Buch ist es zwangsläufig Marie, die zum Katalysator wird. Und deswegen steht da auch das Wort Utopie. Denn in der richtigen Welt passiert das eher selten, dass die Sprachlosigkeit der Kinder die Eltern zum Nachdenken bringt. Man freut sich über den Ausgang der Geschichte, weiß hinterher aber erst richtig, dass das Grau im Leben vieler Menschen doch regiert und klebt und Gefühle macht, die niemand aushalten kann, der noch ein paar Träume hat im Leben.
Nicole Weiligmann „Grün“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 13,40 Euro.
Mit César Econda vier Tage in Paris
In der Welt von Gary, Breton und Dali auf der Suche nach dem eigenen Sinn im Leben

César Econda: Durchschnittliches Leiden. Foto: Ralf Julke
César Econda verrät nicht viel über sein Leben. Nur dass er dem Helden seines Buches, an dem er acht Jahre lang schrieb, doch sehr ähnlich ist: Schweizer, Ingenieurwissenschaftler, 35 Jahre alt und auf vertrautem Fuß mit Camus, Hesse und Dostojewski. Es ist lange her, dass das “Steppenwolf”-Fieber in deutschen Landen grassierte. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht auch im 21. Jahrhundert so einsam fühlen kann.
Was Gründe hat. Auch wenn sie nicht immer alle klar zu benennen sind. Sind die gestrengen Väter schuld? Ist es der Druck der Gesellschaft? Das System einer Schule, die Außenseiter ablehnt, verachtet und niederdrückt? Sind die Probleme des frühen 19. Jahrhunderts noch immer die selben wie die des späten 19. Jahrhunderts? Es sieht ganz so aus. Nur dass man es um die vorletzte Jahrhundertwende irgendwie der “fin de siecle”-Stimmung zuschrieb. Nur einer war hellsichtiger. Und der kommt auch vor in Econdas Weg durch das moderne, so schön anonyme Paris: Siegmund Freud. Nebst weiteren Autoren, denen der Held der Geschichte begegnet ist und deren Bücher ihm vertraut wurden: Romain Gary, André Breton, Paul Watzlawick. Das ist auch schon wieder 30, 40 Jahre her, dass diese Namen in der gesellschaftlichen Debatte eine Rolle spielten. Indirekt taucht dieses beharrliche Nachdenken über unsere Existenz in einer überdrehten Konsumwelt auch bei Econda wieder auf durch Michel Houellebecq, auch wenn der selbst nicht im Buch vorkommt. Aber er war der Anreger, der den jungen Wissenschaftler dazu brachte, sein Buch unter Pseudonym zu schreiben.
Die Handlung passiert in vier Tagen. Vier Tage Ferien, die sich Econdas Romanheld genommmen hat, um sich vom Stress daheim abzulenken und einfach abzutauchen in der großen Stadt mit all ihren Attraktionen, berühmten Bewohnern, ihrer Kunst, den modernen, den alten, den von Problemen geplagten Stadtvierteln. Meist ist er mit der Metro unterwegs, wenn er nicht gerade versucht, Straßen und Plätze zu finden, die sich auch mit Stadtplan nicht unbedingt finden lassen. Und er genießt es, dass er allein da ist, niemandem Rechenschaft schuldet und die Konversation auf das Wesentliche beschränken kann.
Er ist zwar in der Wissenschaft erfolgreich. Aber menschliche Nähe hält er überhaupt nicht aus. Er weiß es. Was ihn von anderen Zeitgenossen unterscheidet. Augenscheinlich ist er auch hochbegabt. Doch an seine Kindheit und die Schule erinnert er sich aus der Perspektive eines Versagers. Und das Gefühl hat ihn auch im erwachsenen Alter nicht verlassen. Kaum eine Situation bringt ihn nicht an seine Grenzen – sei es das Einchecken im Hotel, das Einkehren in ein Restaurant. An seine Doktorprüfung erinnert er sich mit Grausen. Der kleinste Widerspruch versetzt ihn in Panik und sein Gehirn schaltet komplett in den Rechtfertigungsmodus: Was hab ich nur wieder falsch gemacht?
Da und dort fühlt man sich an andere Leidensgeschichten anderer Autoren, auch solchen aus dem Einbuch-Verlag erinnert. Nur reagieren ihre Helden zumeist anders – brechen entweder völlig aus, reagieren mit einer Flucht möglichst weit weg aus den als katastrophal erlebten Umständen. Oder sie gehen dran kaputt, leiden unter Depressionen oder sind stark sucht- oder suizidgefährdet. Der Held in Econdas Geschichte hat einen Vorteil: Er hat gelernt, die Dinge analytisch zu betrachten. Manchmal wird das eine Manie, wenn er sich in verwirrrenden Situationen selbst die sonderbarsten Rechenaufgaben stellt und die gleich noch im Kopf löst.
Doch in Paris passiert noch etwas anderes mit ihm, denn er hat die große anonyme Stadt ja ganz bewusst gewählt, um aus dem Alltagsstress auszusteigen. Bei seinen Fahrten und Spaziergängen hat er jede Menge Zeit, sein Leben Revue passieren zu lassen und dabei immer wieder der Frage nachzugehen, warum es ausgerechnet ihn erwischt hat, ob er damit wirklich eine Ausnahme ist und warum er – selbst wenn er die Dinge perfekt beherrscht – von einem kleinen Einwurf völlig verunsichert werden kann. Dabei rekapituliert er auch allerlei wissenschaftliche Grundlagen. Bis hinein in die Körperchemie: Mit all den Hormonen und was sie mit dem Menschen anstellen, damit der sich eifrig paart, weiß er Bescheid. Selbst die Tischnachbarn nimmt er im Kopf auseinander, analysiert ihren Ist-Zustand als Paar und ihre Zukunft in den nächsten Jahren, wenn die Hormone aufhören, Harmonie zu erzeugen und die sexuelle Anziehungskraft aufhört.
Was hat man eigentlich noch für ein Liebesleben, wenn man die ganzen Vorgänge dabei im Kopf permanent auswertet und nicht einmal ein Vollrausch reicht, den wissenschaftlichen Operator im Kopf auszuschalten? Was dann auch die wenigen möglichen Beziehungen unmöglich macht, in denen ein Außenseiter, als der er sich empfindet, einer Frau begegnet, die bereit ist, sich trotzdem auf ihn einzulassen.
Die mögliche Antwort, die der Held für sich findet, liegt im Gruppenzwang, den er für die Wurzel allen Übels hält. Menschen verändern sich, passen sich den Regeln einer Gruppe an und beginnen Dinge zu tun, die sie als Einzelwesen nie getan hätten. Wozu auch all die kleinen und bösen Schikanen gehören, die Gruppenmitglieder gegen andere, scheinbar schwächere Mitglieder der Gruppe ausüben, um sich selbst aufzuwerten, ihre Position in den Augen der scheinbar Starken zu verbessern. Eine Welt, die der Held nun nur noch von außen betrachtet – er will nicht mehr dazu gehören. Und er fühlt sich besser damit: “Vielleicht ist man unter dem Strich glücklicher, fühlt weniger Schmerzen, wenn man den Freuden und Frauen einfach aus dem Weg geht? Wenn man die Sehnsucht aufgibt, den richtigen Partner zu finden? Wenn man sich einfach nur abschirmt?”
Aber da er eifrig innere Monologe führt, ist der Leser ja dabei, wenn er von den simpelsten Situationen in Angst und Schrecken versetzt wird und innerlich regelrecht zu schreien und zu wüten beginnt. Ganz so glücklich ist er mit sich also nicht.
Aber geht es den Anderen besser? Oder gestehen sie sich ihr Leiden einfach nicht ein?
Fast ein Synonym für die Ängste der modernen Welt sind die Waggons der Pariser U-Bahn, in denen alle eifrig bemüht sind, nur ja keinen der Mitpassagiere anzusehen oder auf irgendwelche Kontaktversuche zu reagieren. Für den Helden dieser durchaus dissonanten Reise durch die berühmtesten Teile von Paris, liegt ein Urgrund der Panik in dem, was auch die Autoren des “fin de siecle” gern thematisiert haben – im Wissen um die Sinnlosigkeit des Lebens. Aber was macht man aus seinem Leben, wenn man darin keinen Sinn (mehr) sieht? Bringt man sich um? Das bringt auch Econdas Held nicht fertig, denn sauber rechnet er negative und positive Folgen gegeneinander auf. Er kennt auch die einschlägigen Schriften zum Selbstmord. Und er sieht, wenn er anderen Menschen so bei ihrem Leben zusieht, die vielen Versuche, sich mit allerlei Dingen einfach über die Sinnlosigkeit hinwegzutäuschen – sei es mit Drogen, mit Religion, mit Kindern, die man in die Welt setzt, um das Ärgernis einfach an die nächste Generation weiter zu geben.
Aber mal ehrlich: Selbst dieser verbiesterte Paris-Reisende schmunzelt, als am Ende auf der Heimfahrt im Zug die Kinder anderer Leute anfangen, den ganzen Waggon zu unterhalten.
Vielleicht ist der größte Denkfehler unserer Zeit (und wohl auch die größte Ursache der meisten Leiden), die eingebaute Erwartung, unser Leben müsste einen Sinn haben. Bibliotheken stehen voller solcher Sinn-Bücher. Und voller Heilsversprechen, die behaupten, einem den Sinn geben zu können für das Leben.
Ein gewaltiges Einfallstor nicht nur für Religionen, sondern auch Ideologien, Sekten, allerlei Gurus und Propheten. Vielleicht hat dieser namenlose Held aus der so frustrierenden Schweiz tatsächlich Recht, wenn er die meisten Zeitgenossen hilflos nach irgendeinem Gruppenanschluss suchen sieht, getrieben von der Panik, als Außenseiter keinen Platz und keine Anerkennung zu finden. Es gibt genug Stellen im Buch, da möchte man den inwendigen Grantler einfach sitzen lassen mit seinem sinnlosen Zorn. Und dann versteht man ihn wieder und ahnt, wie er darunter leidet, nicht Teil haben zu können. Aber woran eigentlich? An den besoffenen Gruppen, in denen er gar nicht sein will? An der Blaskapelle des Vaters oder einer Kirche, die ihm etwas aufdrängt, was sein Verstand ablehnt?
Will er denn der Clochard sein, der auch dann keine Freude hat, wenn er doch noch sein Bier bekommt?
Es ist, auch wenn es sich nicht so liest, doch auch wieder ein Sinnsucher-Roman. Nur dass der Sinn eben nicht im Kosmos schwebt, irgendwo eingewoben in ein göttliches Versprechen. Vielleicht ist das genau das Problem, dem sich die Menschen so langsam stellen müssen, dass der entsetzte Schrei “Gott ist tot” tatsächlich nur noch den Narren am Straßenrand gehört, die es einfach nicht fassen können. Und dass der ganze Rest von Selbstakzeptanz und Selbstbewusstsein unser Teil und unsere lebenslange Aufgabe ist. Was übrigens als trockene Analyse zwischendurch auch in diesem Buch mit vorkommt. Es ist ja nicht so, dass dieser reisende Außenseiter sich nicht vollgefressen hätte mit allem möglichen Wissen.
Immerhin hat er – das weiß er auch, ein paar Handlungsoptionen, auch wenn er diese kurzen Ferien in Paris erst einmal ohne Ergebnis zu Ende bringt. Jedenfalls ohne ein greifbares Ergebnis. Noch gibt es viel zu viele Gründe, keinen Selbstmord zu begehen. Irgendwie sind ihm die Anderen, so seltsam ihn ihr Handeln anmutet, doch irgendwie wichtig. Was ja schon mal ein Anfang ist. Die Anderen sind eben nicht nur die Hölle. Klammer auf: Viele sind es trotzdem. Aber bei denen muss man ja keine Freunde suchen. Klammer zu.
César Econda “Durchschnittliches Leiden”, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 13,90 Euro
Eine wütende Biografie aus dem dunkelsten Leipzig
Der Albtraum einer Kindheit in einer von Alkohol und Gewalt zerfressenen “Familie”

Annett Leander: Umarme mich – aber fass’ mich bloß nicht an! Foto: Ralf Julke
Es kommt ganz unauffällig in Weiß daher. Es ist auch keine kreischende Biografie, mit der der Leipziger Einbuch-Verlag nun die Bestseller-Listen rocken will. Auch wenn es für den kleinen Leipziger Verlag wieder einer dieser mutigen Vorstöße ist, die in großen Verlagen kein Controller zulassen würde: Die Lebensgeschichte einer jungen Leipzigerin, die wütend ist, richtig wütend.
Und anfangs denkt man noch: Das geht eigentlich nicht. So ungedämpft kann man doch die Wut nicht rauslassen auf die eigenen Eltern. Aber dann nimmt die junge Autorin ihre Leser mit in eine Kindheit, wie man sie im Leipzig der 1990-er Jahre eigentlich nicht vermutet hätte, eine Kindheit mit Eltern, die schon weit vor der Geburt der Kinder sämtliche Lebenskoordinaten verloren haben, beide dem Alkohol verfallen und schon seit Jahren betreute Klienten von Sozial- und Jugendämtern. Mehrfach wurden ihnen schon Kinder entzogen – die ältesten mit schwersten Behinderungen, die möglicherweise nicht nur in Alkohol- und Tabakkonsum während der Schwangerschaft ihre Ursache haben, sondern auch in groben Misshandlungen des Mannes, den die Autorin irgendwann nur noch verächtlich den Erzeuger nennt.
Und obwohl die zuständigen Ämter um diese Karrieren wissen, handeln sie bis ins Jahr 2001 so, als könne man so eine Familie mit Ratschlägen, wechselnden Betreuern und immer wieder Hilfe in letzter Minute, wenn die Wohnungskündigung drohte, auf den richtigen Pfad führen.
Die Akte, die die Autorin letztlich einsehen kann, erzählt von einer Amtsbetreuung, die eigentlich alle Signale auf dem Tisch liegen hatte – und trotzdem nicht die richtigen Schlüsse zog. Man fühlt sich wohl zu Recht an einige dramatische Vorfälle in der jüngeren Leipziger Geschichte erinnert: Wenn Betreuer nicht einschreiten, obwohl sie um die massiven Störungen und Probleme der Eltern wissen, endet das oft genug auch mit dem Tod der Kinder.
Erst recht, wenn ein Mann wie der hier geschilderte Vater die Hauptrolle spielt, nicht nur völlig alkoholabhängig und faul, sondern auch noch ein Tyrann, wie er im Buche steht, einer, der seine Familie mit Gebrüll und Gewalt einschüchtert. Und nicht nur die eigene Frau hat er so gefügig gemacht, dass sie nicht einmal mehr ein Wort des Widerspruchs wagt. Auch die Kinder bekommen den Jähzorn und die schnell in Schläge ausartende Herrschsucht dieses Mannes zu spüren, der Monat für Monat das Geld der Familie versäuft.
Die Kinder müssen nicht nur in alten, von irgendwo spendierten Kleidungsstücken in die Schule – sie sind auch verlaust und erleben immer wieder Tage völlig ohne eine Mahlzeit. Und trotzdem schreitet niemand ein. Augenscheinlich bekommt die Lehrerin nichts mit, die Nachbarn hören wohl den täglichen Lärm aus der Wohnung. Protokolliert aber sind nur die gewalttätigen Ausfälle des Vaters gegen die Mutter, nicht die gegen die Kinder. Doch für die vergeht eigentlich kein Tag ohne Prügel. Und es kommt irgendwann auch, wie man es von Anfang an befürchtet, dass der Mann, der nicht einmal ansatzweise die Rolle des Vaters ausfüllt, sich auch sexuell an seiner Tochter vergreift.
Und das ist der Punkt, an dem man weiß: Dieses Buch ist ein ganz seltenes. Denn die Autorin schafft etwas, was die meisten Kinder, die so eine Lebenserfahrung hinter sich haben, niemals schaffen: Sie schafft es, über all das zu schreiben. Die meisten scheitern daran, verschließen es für ihr ganzes Leben in sich. Denn diese Art schwarze Pädagogik, wie sie Alice Miller nennt, formt den Charakter fürs ganze Leben und zerstört jede emotionale Basis. Sie legt die Grundlagen für Traumata, Panikattacken und Krankheiten, die die Betroffenen immer wieder in die Gefahr bringen, sich selbst zu zerstören. Ob mit Alkohol, Tabletten oder Zerstörungen des eigenen Körpers. Die früh erlebten Aggressionen durch die eigentlich wichtigsten Menschen im eigenen Kindheitserleben werden zur Aggression gegen sich selbst. Und helfen können am Ende auch nur ansatzweise lange, quälende Therapien.
Von denen die junge Autorin schon einige hinter sich hat. Doch das bewahrt sie nicht davor, unversehens von neuen Panikattacken heimgesucht zu werden. Was ihr augenscheinlich auch passierte, als der größte Teil ihrer Geschichte schon zu Papier gebracht war. Da genügte ein einzelner, nach Alkohol und Qualm stinkender Fahrgast in der Straßenbahn.
Auszüge aus der Akte des Jugendamtes am Ende des Buches erzählen von der Tragödie der Verwaltung, die mit den falschen Ansätzen über Jahre versuchte, eine Art “Rettung der Familie” zu bewerkstelligen, obwohl man über die Vernachlässigung der Kinder eigentlich Bescheid wusste.
Am Ende sind der Weg ins Heim und die Aufnahme in eine Pflegefamilie die Rettung für das Kind und auch die so wichtige Erfahrung, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bedingungslos sorgen und lieben und Kindern Geborgenheit vermitteln können. Auch mit allen Problemen, die so eine Beziehung mit sich bringt. Denn die Aggression, die das gequälte Kind über Jahre erfahren hat, bricht sich auch in ihrer Pflegefamilie immer wieder Bahn.
Am Ende versteht man die ungebremste Wut. Da teilt man sie auch. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie tief verletzt Menschen ihr Leben lang sind, die so eine Kindheit erlebt haben. Und was wahrscheinlich passiert, wenn sich die jungen Erwachsenen diesen traumatischen Erfahrungen nicht stellen, sondern sie – mit den von den “Eltern” gelernten Mitteln – verdrängen.
Die Autorin hat sich gestellt – mit einem erstaunlichen Mut. Auch mit einer bestechenden Offenheit. Und eigentlich steckt auch ein Appell darin an unsere Gesellschaft, mit all der so gut geübten Schönmalerei einmal aufzuhören. Man kann solche “Familien” nicht reparieren, nicht mit Beratungen zur ewig leeren Haushaltskasse und nicht mit Tipps zur modernen Erziehung. Man kann nur die betroffenen Kinder so schnell wie möglich retten und aus diesen desolaten Verhältnissen herausholen.
Denn wenn das nicht passiert, sind es die betroffenen Kinder, die ihr Leben lang leiden. Und das erst recht da, wo andere Menschen gelernt haben zu vertrauen und sich sicher zu fühlen.
Annett Leander “Umarme mich – aber fass’ mich bloß nicht an!”, Einbuch Buch- und Literaturberlag, Leipzig 2015, 11,90 Euro
Heiner allein im Dorf
Eine etwas unfertige Geschichte aus der thüringischen Einsamkeit

Lorenz Kindel: Das ICH ist eine vorübergehende Festlegung. Foto: Ralf Julke
Es gibt Bücher, die sind eigentlich noch nicht fertig. Dies hier ist so eins. Eigentlich soll es der erste Teil eines Romans in drei Teilen sein. Aber auch Romane in mehreren Teilen funktionieren nur, wenn sie das Spannungsmoment aufbauen und offen halten können. Erinnerungsarbeit ist etwas anderes.
Und das, was der Thüringer Lorenz Kindel hier vorlegt, ist eigentlich Erinnerungsarbeit. Sogar eine zu einem nicht ganz unwichtigen Thema, jenem nämlich, das Politiker gern so ratlos als „demografische Entwicklung“ bezeichnen und ostdeutsche Dagebliebene heute gern mit dem alten Slogan von Helmut Kohl belegen: „blühende Landschaft“. Wirklich blühende Landschaften: Dörfer und Flecken, aus denen mittlerweile die letzten Bewohner verschwunden sind, leer gezogene Landschaften. So wie das Spindorf in Kindels Buch, in dem der Held Heiner versucht, sein Leben zu sortieren. Er ist der Letzte.
Eigentlich war seine Oma Elfriede die Letzte. Bei ihr hatten die anderen Dorfbewohner, als sie der Arbeit und einer besseren Zukunft hinterher zogen, ihre Hofschlüssel abgegeben. Doch Elfriede ist jetzt auch tot und Heiner ist eingezogen in ihr Haus, das ihm sowieso schon immer Rückzugsraum war – auch damals schon, irgendwann kurz nach der „Wende“, die Kindel ohne Anführungszeichen schreibt, während er die hingestorbene DDR nur als DäDääR bezeichnet. Selbst so etwas verrät, wie komplex das Gespinst ist, das der Autor hier weben will. Und wie schwer er sich damit tut, denn da geht es ihm augenscheinlich wie so vielen Autoren im Osten: Sie haben ein Problem mit dieser Vorgeschichte. Ein unverkrampftes Verhältnis sieht anders aus. Die DDR spukt durch die gesamtdeutsche Erinnerung wie ein unerwünschter Verwandter, der besoffene Alfons, der sich auf jeder Feier blamiert und daneben benommen hat. Die einen Autoren machen sich lustig über Stasi &. Co., die nächsten schreiben düstere Thriller drüber. Und wenn der Alltag mal auftaucht, dann tun die meisten Autoren so, als wäre das alles nur noch peinlich, lächerlich, als schäme man sich dafür und würde sich mit dem flehenden Kichern des Klassenclowns dafür entschuldigen, dass man dummerweise die falsche Kindheit im falschen Land erwischt hatte.
Dabei ist dieses nun immerfort getrötete „falsche Leben im falschen“ nur noch nervend. Was soll das?
Das Alles steckt auch in Kindels DäDääR. Und es macht einen guten Teil der Ratlosigkeit seines Helden aus, der nun in diesem verlassenen Spindorf sitzt und versucht, sein Leben zu rekapitulieren. Das tut er im Zwiegespräch mit sich selbst, ist ja sonst weiter keiner da. Die Gefahr, so in der Einsamkeit närrisch zu werden, ist ihm durchaus bewusst. Und auch ein wenig peinlich, wenn dann doch mal ein paar Touristen auf Rädern durchkommen. Denn das gebrochene Verhältnis bezieht sich nicht nur auf das Land, das 1990 seine große Entvölkerung erlebte, sondern auch auf seinen Beruf, den er nach der „Wende“ an den Nagel gehängt hat, weil er in einer Arbeit als Musiklehrer einfach keinen Sinn mehr sah. Seitdem scheint das Prekäre zu seinem Leben zu gehören.
Und man erfährt auch so nach und nach, dass es da mal eine Romy gab, von der der einsame Heiner eher störrisch erzählt, als wär’s nur eine etwas unglückliche Liebelei im letzten Sommer gewesen. Erst am Ende dieses ersten Teils seines Romans erfährt man, dass das mal eine Liebe fürs Leben war, dass beide auch verheiratet waren und mindestens einen gemeinsamen Sohn hatten. Das erfährt man quasi eine Sekunde vor Schluss. Es ist einer der Gründe dafür, warum man sich am Ende fragt, warum der Autor seine Geschichte nicht einfach runtergeschrieben hat, alles, was er in drei Teilen erzählen möchte.
Dann hätte man noch kürzen und straffen können und es hätte ein griffiges Buch aus der thüringischen Provinz werden können. Aber auch der Untertitel „Gespinste aus Thüringen“ deutet darauf hin, dass der Autor doch ein wenig zu viel der ganzen deutschen Moritatenliteratur gelesen hat. Deutsche Autoren halten Grübeln und Spinnen für wichtig, ummalen die Gedanken ihrer Helden gern ausführlich, laden Landschaften und Dörfer mit Geraune auf, überhöhen und lassen Bedeutungen schwängern. Das macht Geschichte sehr gespinstig. Keine Frage. Aber eigentlich schaden sie dem Roman, der Story. Der Leser wird zu recht ungeduldig und fragt sich: Wann geht’s denn nun los? Wann packt er seine Handlung am Faden und erzählt sie konsequent herunter?
Natürlich weiß man all die teuren Erfindungen der deutschen Erzählkunst zu schätzen, all diese Rückblenden, Einschübe, Abschweifungen, inneren und äußeren Monologe. Aber erfunden wurden sie in Zeiten, als Menschen noch mit der Postkutsche fuhren und der Taugenichts zu Fuß durch die romantischen Landschaften spazierte. Dieser alte romantische Blick auf Heimat, Dorf und Liebe scheint man nicht totzukriegen. Aber ist es nicht höchste Zeit, diese Verklärung endlich mal zu entsorgen? Verlassene Dörfer sind pittoresk, aber nicht romantisch, vergangene Lieben schmerzlich, aber nicht lyrisch.
„Lyrische Geschichten aus einem deutschen Raum“? Das ist wie DäDääR: Verklärung und Schminke. Eine naive Verklärung, die aber irgendwie passt zum Selbstbild der ostdeutschen Provinz. Alles ist schon geschehen. Nichts kommt mehr, nicht mal mehr der Bus. Nur Heiner ist noch da und wird nicht fertig mit seiner Geschichte. Und deshalb steht dann dieser Titel da, der so klingt, als müsste sich jeder erst ein Ich basteln. Sehr gespinstig. Und eher nichts für Leute, die sich in Thüringens Wäldern auch mal ein bisschen Action wünschen.
Lorenz Kindel „Das ICH ist eine vorübergehende Festlegung„, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 12,90 Euro.
Unruhige Tage für Rentner Kuno Kropke
Drei Morde und ein alter Mann in einem gar nicht so verschlafenen Nest in Hessen
Martin Lenz: Keine Schuld und keine Ahnung. Foto: Ralf Julke
In Krimis sind meistens die Ermittler die Helden. Manchmal auch die Mörder. Aber um die am Rande Betroffenen kümmern sich Krimi-Autoren eher selten. Vielleicht, weil das eigentlich die ganz normalen Leute sind, die sich von all den Schreckensmeldungen in der Zeitung eher nur verängstigen lassen. Aber wie reagiert einer wie der Rentner Kuno Kropke, wenn ein blutiges Verbrechen seine Welt erschüttert?
Verängstigt war er schon vorher, denn Tag für Tag liest er seine Zeitungen und grübelt darüber, wie kriminell die Welt mittlerweile geworden ist – auch wenn er ab und an auch mal darüber nachdenkt, warum in den Zeitungen Mord und Totschlag derart breit ausgewalzt werden. Wäre da nicht seine realistische Lebensgefährtin Christa, er wäre wohl schon längst in den Kosmos des völlig wahnhaften Alten abgeglitten. Denn eigentlich bietet das kleine Nest in Hessen, in dem er lebt, nicht allzu viele Gründe dafür, die Welt als Albtraum zu begreifen.
Würde da nicht unverhofft ein kleines Mädchen anrufen und Onkel Kuno bitten, schnell, schnell zu kommen. Denn ihre Mama ist ermordet worden. Das Mädchen Anika versetzt den von seinem Medienkonsum reineweg wirren Kuno in Angst und Schrecken, auch wenn er die ersten Momente mit Leiche, Anika und Polizei ganz ordentlich meistert. Nicht allzu sehr geschockt, auch wenn die Tote Mechthild Popescu ihm keine Unbekannte ist: Sie hat in den Apotheken geputzt, die er noch kürzlich betrieben hat, und sie putzt auch regelmäßig in der Villa, die er mit Christa bewohnt.
Aber Christa ist weit weg – auf einer Reise in Chile. Er muss ganz allein zurecht kommen mit den Problemen, die der Todesfall jetzt aufwirft. Denn mittendrin in der Geschichte steckt er spätestens, als Anika klitschnass in seinem Haus auftaucht und ihn verdonnert, ja nicht zu verraten, wo sie ist. Ein selbstbewusstes Mädchen. Weiter hinten in seinem Roman, in dem Martin Lenz noch einige sehr interessante Persönlichkeiten aus Christas weitem Freundeskreis auftreten lässt, findet sich auch ein sehr freundliches Plädoyer des Autors für diese jungen, noch nicht eingeschüchterten Persönlichkeiten in der Grundschule, kluge Biester, denen eigentlich nichts fremd ist, was die Erwachsenen tun. Und auch Anika weiß, was gehauen und gestochen ist. Und da sie bei den diversen Putzjobs ihrer Mutter öfter dabei war, weiß sie auch, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Und sie kennt Kuno. Besser als er selbst.
Es ist tatsächlich eine Geschichte, in der Martin Lenz eine einfühlsame Begegnung über den tiefen Graben der Generationen hinweg geschrieben hat. Denn wenn sich einer einigelt wie Kuno Kropke, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er genauso ein verunsicherter, lebensfremder, grantiger alter Kerl wird, wie er einem in den Abgründen der großen und der kleinen Provinz nur zu oft begegnet – vom Skandal-Geprassel der konsumierten Medien völlig überfordert, zunehmend panisch mit Blick auf die Welt, die Mitmenschen und die Jugend und die Ausländer sowieso.
Auch wenn er sich alle Mühe gibt, Verständnis zu zeigen – für Anikas rumänischen Vater, für den türkischen Müllmann, für Anikas Mama sowieso, denn ganz vorsichtig erinnert er sich daran, dass er mit Mechthild auch mal ein paar sehr verschämte Begegnungen hatte im Keller.
Natürlich gibt es auch einen ordentlichen Ermittler in diesem Krimi, Kommisar Pfitzer. Ist ja nicht der erste Krimi, den Martin Lenz geschrieben hat, auch wenn es sein erster im Einbuch-Verlag ist. 1933 in Halle geboren, hat er 1957 die DDR verlassen, war als Gymnasiallehrer in Hessen tätig. Seit 1993 ist er pensioniert und schreibt. Unter anderem auch Krimis. Krimis, in denen er seine hessische Wahlheimat zum Schauplatz macht, in denen er aber auch recht lustvoll die Charaktere seiner Ermittler zuspitzt, bis eine kleine Parodie draus wird. In diesem Fall ist der übereifrige und karriereversessene Ermittler im Team mal nicht der geschniegelte Wessi im Osten, sondern ein Thüringer in Hessen. Bei Lenz wird er für seinen Übereifer prompt bestraft.
Denn nicht nur Kuno Kropke hat eigentlich von den Verhältnissen in seiner nächsten Nachbarschaft keine Ahnung. Das hat er immer seiner Christa überlassen. Deren beste Freundin wohnt gleich gegenüber, ist Psychologin und kennt auch all die Kümmernisse der tragischen Helden in dieser Geschichte. Auch die des nun als Mörder verdächtigten Herrn Popescu, dessen Geschäftstätigkeit sich zwar als eine sehr dubiose herausstellt – aber seine Lebensgeschichte hat es in sich, und so scheint der Fall auch in die jüngere finstere Geschichte Rumäniens zu führen, erst recht, als ein zweiter Toter gefunden wird und ein dritter …
Doch während Pfitzer seine Arbeit macht und am Ende einen Mörder erwischt, mit dem sonst keiner gerechnet hat, braucht es bei Kuno ein bisschen mehr Geduld, ihm die ganze Geschichte beizubringen, bis er einigermaßen begriffen hat, was er all die Jahre nicht mitbekommen hat. Selbst Anika weiß mehr von der Welt und von ihrem komischen Onkel Kuno, als Kuno selbst. Es scheint also wirklich kein gutes Altersrezept zu sein, sich über die Welt reineweg aus Zeitungen und Abendnachrichten informieren zu wollen. Da wird man völlig närrisch, versteht aber am Ende gar nichts mehr, selbst wenn es die Journalisten versuchen, lang und breit zu erklären. Da lässt man dann die Tuja-Hecken wachsen, bis keiner mehr ins Haus gucken kann, und zieht den Kopf ein, wenn das Telefon klingelt.
Am Ende tut sich für Kuno doch noch eine völlig neue Welt auf, vor der er sich nun seit Tagen zutiefst gefürchtet hat. Doch an dieser Stelle ist Martin Lenz ein kleiner Spielverderber. Vielleicht ist auch der Kroatzbeerlikör schuld, den Kuno immer dann schnasselt, wenn ihm die Nerven durchgehen. Jedenfalls ist auf Seite 238 finito und Martin Lenz erklärt in kursiv, dass alles nur erfunden ist und keiner sich getroffen fühlen sollte, auch wenn er sich ertappt fühlt. Kann ja passieren in der hessischen Provinz. Oder anderswo. Alte, von Angst gebeutelte Männer mit dem Weltbild einer Maus gibt es überall.
Martin Lenz “Keine Schuld und keine Ahnung“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2015, 13,90 Euro
Wenn die Urenkelin die Lebensgeschichte ihrer Uroma erzählt: Mama Luise
Man hat es doch glatt verpasst …
So erzählt Katja Lenßen zwar stellvertretend für ihre Urgroßmutter deren Geschichte, erschafft aber wohl auch mit viel Liebe zu ihrer Heldin eine dichte, atmosphärische Lebensgeschichte, die auch nicht 1947 endet, als die kleine Familie wieder beisammen ist, sondern weiterläuft bis 1982, bis zum Tod Luises. Man erfährt, wie die Heldin und ihre kleine Familie, nachdem sie alles verloren haben, mit ostpreußischer Beharrlichkeit ihr neues Leben anpacken und sich eine neue Existenz aufbauen, aus dem Vorgefundenen das Beste machen und natürlich auch zutiefst erschüttert sind, wenn das Tragische wieder eingreift in ihr Leben.
Das sind die eigentlichen Romane, die Bestand haben werden, gerade dann, wenn ihre Hauptfiguren so lebendig werden wie Luise in Katja Lenßen geglücktem Versuch, die irgendwie immer offen gebliebene Familiengeschichte nun einmal wie eine große, herzliche Parabel auf das Leben zu erzählen. Ihre eigene Geschichte – die Begegnung als Baby mit der Urgroßmutter im Krankenbett – gehört dazu. Und am Ende weiß sie dann auch, warum die Geschichte immer noch rumorte im Familienkreis. Jetzt wird sie auf andere Weise weitergegeben – als Buch, eines der wichtigsten und emotionalsten im Programm des Einbuch-Verlages.
Mal ein echter Leipziger Bildungsroman: Eichenlaub oder die ermutigende Rolle des Rhinozeros
Das Ergebnis ist – Goethe lässt grüßen – ein alkoholgetränkter, manchmal zermürbender, am Ende aber erstaunlich an Tempo gewinnender Bildungsroman, in dem Max (Juliette sei dank) ein Stück weit seine Schüchternheit überwindet, sich am Schopf aus dem Tran zieht und seinem Prof. zeigt, dass an ihm auf jeden Fall kein kluges Kerlchen verloren gegangen ist.
Immerhin schreit er den Richtigen an, der auch mit Restalkohol im Blut noch ahnt, dass das keine rhetorische Frage ist, sondern dieser wunderliche Kauz wirklich noch seine Schüler erreichen will und mehr von ihnen will, als auswendig gepaukte Sätze.
Wotans Schatten: Ein Roman aus den kreuzgefährlichen Randbereichen der modernen Verschwörungsmythen
So weltfremd ist die Fiktion ja nicht. Manche Gegenden im nördlichen Bandenburg und in Vorpommern können ein Lied davon singen von diesen seltsamen Neusiedlern vom rechten Schlag, die sich in ihren Gemeinden als Wohltäter gerieren und da und dort auch gut bewachte Ferienlager gründen, in denen mal wieder andere Erziehungsmethoden gelten. Im Grunde gibt es genug Stoff in diesem Buch, der erschrecken ließe, wenn nicht gerade die letzten Jahre gezeigt hätten, wie leicht Menschen sich von den krausesten Behauptungen und Mythen lenken lassen und dann auch noch glauben, sie hätten eine neue Wahrheit gefunden, würden jetzt endlich sagen dürfen, was irgendwer verboten hat zu sagen.
Das Buch passt also erstaunlich sauber in die Zeit, auch wenn Hilmsen – wie Shea und Wilson – seine Freude daran hat, die wilden Verschwörungsphantasien aufzudröseln, etwas ernsthafter als die beiden Amerikaner. Denn ganz so lustig wirkt der Mythos von einer am Pol versteckten Herrenrasse ja nicht aus der neueren, deutschen Perspektive. Da wabert wieder was. Oder immer noch. Und es verbrüdert sich eifrig mit den nationalistischen Schlagedraufs aus der Nachbarschaft, die für ihre Länder genauso obskure nationalistische Legenden träumen.
Im zweiten Buch von Jo Hilmsen entwickelt sich diese Melange zu einer zuweilen sehr dramatischen wilden Jagd, bei der nicht wirklich klar ist, ob der Autor seine Helden am Ende der Geschichte alle wieder unversehrt einsammeln kann. Da und dort greift er zur liebevollen satirischen Überspitzung, denn ein wenig ist das Buch ja auch sein Beitrag zu all den heute so beliebten Veschwörungs-Romanen – man denke nur an den wilden Hype um den “Da-Vinci-Code”. Es gibt augenscheinlich viele Menschen, die sich für solche Mysterien-Spiele begeistern. Und nicht alle nehmen sie als das, was sie eigentlich sind: gut gemachte Gedankenspiele mit einem gewaltigen Schuss Phantasie. Die Grenzen sind fließend. Und etliches, was Hilmsen seine Neuschwabenländler träumen lässt, stammt eigentlich aus alten Fantasy-Schwarten – wie hier aus Edgar Bulwer Lyttons “The Coming Race”. Aber wie man weiß, konnten und wollten das auch schon im 19. Jahrhundert einige Leute nicht auseinander halten. Und im 20. und 21. ist das nicht anders. Im Gegenteil: Die Sehnsucht vieler Menschen nach einem gewaltigen Schuss Mystik und Esoterik in ihrem Leben scheint riesengroß. Und die Verführbarkeit, die Welt als mystische Veschwörungskulisse zu betrachten, auch.
In gewisser Weise versucht Jo Hilmsen ja diese neuen, alten Geister in seiner temporeich erzählten Geschichte zu jagen und zu bannen. Wohl wissend, dass es in der Realität mehr braucht als einen kauzigen Kommissar Mewes und zwei, drei tapfere Zivilisten, die den Kopf nicht einziehen, wenn sie merken, dass ein Typ wie Wiltberg sein Unwesen treibt.
Ein SF-Roman mit Liebe, Action und grimmiger Hoffnung: Jennifer Lehrs “Stranger 2905”
Das Ergebnis ist dann möglicherweise so eine Welt, wie sie Jennifer Lehr als Hintergrund gewählt hat für ihre Flucht-Geschichte quer über den Kontinent, aufgeladen mit Spannung, denn wenn die Bösewichter auch noch den Zugriff auf die eigenen Sicherheitssysteme haben, wird jeder Schritt verräterisch, gibt es auch für Elizabeth und ihre Mission keinen Schutz mehr. Es ist ein bisschen wie bei James Bond (und da und dort zitiert Jennifer Lehr auch gern die zu Filmruhm gelangten Helden des Genres): Die Gegenseite hat immer einen Vorsprung und kann über Mannschaften und Material verfügen, das den Helden der Geschichte nicht zur Verfügung steht. Ohne ein paar Superman-Eigenschaften geht es nicht. Es ist ein Rennen gegen die Zeit (aus vielerlei, nicht unbedingt leckeren Gründen) und es gibt immer wieder die bekannten filmreifen Showdowns, die die Mission öfter an den Rand des Scheiterns bringen.
Seelenbruder: Ein hoch-emotionales Novellen-Debüt
Was Lina von Anfang an nicht gelingt. Da sind nicht nur Landkinder giftig, wenn Mitschüler die Cliquen-Norm nicht erfüllen. Oder sich gar in einer Weise entwickeln, die der Dorfklatsch nicht einzuordnen weiß. Wie es Basti geht, dem das Lernen leicht fällt, und der dann doch sein Medizinstudium schmeißt, weil er seine Gefühle im Seziersaal nicht in den Griff bekommt. Dass er zurückkommt ins Dorf und lieber in der Autowerkstatt aushilft, versteht keiner. Am Ende finden sich die beiden Außenseiter, kommen aber dennoch irgendwie nicht zusammen. Und dann wirft auch noch ein Motorradunfall beide aus der Bahn, die Beziehung bekommt einen Knacks.
Und Grit Kurth erzählt auch nicht alles zu Ende. Das Wichtigste ist erzählt. Alles ist offen.
Der Geschichte ist dann noch ein Berg Gedichte angehängt. Aber die muss man nicht unbedingt lesen, auch wenn sie die Lebensgeschichte der Heldin ein bisschen ergänzen sollen. Wirklich gebraucht werden sie nicht. Und der Vergleich fällt auch eindeutig aus: In Prosa vermag Grit Kurth ihre Emotionen wesentlich konkreter und sinnfälliger zu gestalten als im Vers. Manchmal muss man sich einfach entscheiden für eins. In diesem Fall dürfte es für die Novelle sein.
Deutschlandsonate: Paul Hofmans versucht’s mal mit einer Pulp-Fiction-Geschichte
Raus aus dem falschen Leben: Ein Himmel voller Haie
 Hanna Montag: Ein Himmel voller Haie.
Hanna Montag: Ein Himmel voller Haie.
Es wird ein harter Sommer für Anna, denn nicht nur Oma Pauline verliert sie, auch Matty ist nicht da, als es ihr so richtig dreckig geht. Die Briefe an ihn versteckt sie in seiner Wohnung, während Matty mit seiner Band auf Tournee ist. Briefe, die Anna auch den Leser nicht lesen lässt. Da ist sie eigen. Denn wirklich Vertrauen hat sie nur zu ganz wenigen Menschen. Nicht genug. Das erfährt der Leser erst nach diesem dunklen Sommer, als Matty die Briefe findet und endlich erfährt, was los ist mit Anna. Zumindest einen Teil davon. Genug, um die Welt ein wenig zu verändern und auch den Kreis, der sich um Anna bildet. Denn nicht nur ihr geht es so, dass sie sich völlig auf der falschen Spur fühlt. Bei Matty wusste sie es schon. Nicht umsonst bevorzugt er die Musikerlaufbahn. Aber dass auch ihr sonst so strenger und auf Ordnung bedachter Vermieter Johannes austickt, das überrascht dann beide. Auch Johannes hat nur versucht, den Erwartungen eines schweigenden und über allem schwebenden Vaters gerecht zu werden.
Es könnte schon jetzt der Anfang einer Geschichte des gemeinsamen Ausbruchs werden. Aber so weit ist zumindest Anna noch nicht. Da ist noch etwas, was sie keinem erzählt hat, und es ist eine fast überstürzte Fahrt nach Italien nötig, damit auch diese Hülle noch fällt und – neben Annas Krankheit – auch ihre Neigung sichtbar wird, alles loszulassen, aufzugeben, sich aus dem Leben fallen zu lassen, ohne Gegenwehr. Das überfordert dann auch ihre Begleiter. Und Hanna Montags Geschichte könnte durchaus tragisch enden. Denn wo bleibt dieses Stückchen Zuversicht, wenn man nicht einmal mehr den Moment festhalten will oder diese Freundschaft zu zwei Gleichgesinnten, die auch Liebe sein könnte?
Ein Aussteigerbuch irgendwie, das tatsächlich ein Einsteigerbuch ist. Auch für jene, die darüber verzweifeln wollen, dass ihnen der Sprung auf die Erfolgsmaschine einfach nicht gelingen will. Patrick Zschocher vergleicht das Buch mit Salingers “Franny und und Zooey”. Und auch das trifft zu. Und am Ende muss man die Geister einer auf Karriere getrimmten Welt wohl wirklich zum Teufel jagen, wenn man überleben will. Oder gar, wenn man sein eigenes Leben will und nicht das, das andere von einem erwarten. Die Entscheidung, das weiß Anna am Ende, ist ihre eigene. Das ist dann die Szene mit dem Himmel volle Haie. Aber das ist in diesem Fall kein bedrohliches Bild.
Der Bundesrepublikpalast: Die wehmütigen Erinnerungen eines abgerissenen Hauses
 Tino Schreiber: Der Bundesrepublikpalast.
Tino Schreiber: Der Bundesrepublikpalast.
Man suchte dann eifrig nach einer neuen Mehrzwecknutzung, die sehr zum Erstaunen Tino Schreibers doch tatsächlich in Vielem der Mehrzwecknutzung des Palastes der Republik als Tagungs-, Kongress- und Kulturhaus ähnelte. Ergebnis war ein “Humboldt-Forum”, das die Kubatur des alten Preußenschlosses aufnimmt, aber nur drei Straßenfronten und den einstigen Schlüterhof rekonstruiert, die Schauseite zur Spree wird modern nachempfunden, das Innenleben des Bauwerks wird sowieso komplett modern.
Im Juni 2013 legte Bundespräsident Joachim Gauck den Grundstein für den Neubau, der nun wohl mindestens 670 Millionen Euro kosten wird. 590 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung, 80 Millionen Euro für die Fassadenrekonstruktion sollen durch Spendengelder gesammelt werden. Ursprünglich sollte schon 2011 Baubeginn sein, jetzt geht es wohl 2014 los. Aber wie gesagt – es ist ein amtliches Großprojekt. Da werden einige Leute gespannt sein, wie sich die Kosten entwickeln.
Vieles von dem erzählt Tino Schreiber freilich nicht. Zu tief sitzt in ihm die Verletzung über den Abriss des Palastes der Republik, der für seine Zeit und DDR-Verhältnisse sowieso natürlich ein kleines technisches Wunderwerk war. Nach einer Auseinandersetzung mit der Fehde Palast vs. Schloss taucht Tino Schreiber in die knapp 30 Jahre Geschichte des Bauwerks ein, erzählt von den Bauarbeiten und den Einweihungsfesten, von den Parteitagen und Volkskammersitzungen, den Theateraufführungen und den Aufsehen erregenden Konzerten im Palast. Zumindest aus (Ost-)Berliner Sicht muss der Bau tatsächlich eine große Attraktion gewesen sein. Vielleicht sieht man die Sache aus dieser Perspektive ein bisschen anders als etwa aus sächsischer Perspektive, denn die Ressourcen, die hier freigiebig verbaut wurden, fehlten logischerweise andernorts.
Schreibers Position ist durch die gewählte Hauptperson natürlich deutlich. Das Wort Autobiographie trifft es wohl am besten, Polemik oder Streitschrift wäre auch nicht ganz falsch. Ein Roman ist es wirklich nicht. Dazu hätte es einiger handelnder Protagonisten und eigenständiger Handlungsstränge mehr bedurft. Aber für alle, die gern nachlesen wollen, wie emotional die Debatte um den Palast und seine Entfernung geführt wurde, ist Schreibers Buch natürlich eine aufwühlende Lektüre. Fast möchte man gleich selbst ein Transparent malen und losrennen und irgendwie dafür oder dagegen protestieren.
Aber das wird wohl nichts nützen. Wenn sich ein paar Staatssekretäre erst einmal in den Kopf gesetzt haben, dass etwas weg muss, dann kommt es auch weg. Die demokratischen Beschlüsse dafür organisiert man sich schon. Und wenn man Geld braucht für einen neuen Protzbau, dann findet sich auch das – und wenn man dafür Schulden aufnehmen oder die Steuern erhöhen muss. Da ähneln sich politische Sachwalter irgendwie immer. Ob das neue Schloss, das dann nur noch von außen so aussehen soll, seinen Zweck erfüllt und Berlins historische Mitte wieder bereichert, ist dann eine ganz andere Frage. Die gewählte Dimension des Bauwerks spricht eigentlich dagegen. Aber so ist das ja meistens mit Großprojekten.
Lausbubengeschichten aus der Lausitz: Die Karasekbande
 Klaus Singwitz: Die Karasekbande.
Klaus Singwitz: Die Karasekbande.
Man spürt beim Lesen die Freude des nunmehr keineswegs mehr lockenköpfigen Klaus, seine Lausbubenabenteuer für die Enkel aufzuschreiben. Doch wie das mit liebevoll erzählten Lausbubengeschichten so ist: Viele einstige und neuere Lausbuben werden sich darin wiedererkennen, gerade auch, weil Klaus ein bisschen so ist wie alle – manchmal auch schrecklich naiv und blauäugig. Das ein oder andere Abenteuer hätte auch ganz anders ausgehen können.
Und manchmal fühlt man natürlich mit, in was für eine peinliche Situation sich der kleine Möchtegern-Räuber da nun wieder hinein geritten hat. Und es dürfte auch so manchen heutigen Enkel in pure Aufregung versetzen, wenn es um die Lösung geht: Wie kommt er da nur wieder heraus? – In anderen Kinderbüchern setzt es nach solchen Streichen eine ordentliche Tracht Prügel. Und der Vater von Klaus hat so etwas wohl noch erlebt. Aber der Lehrer Richter, der für Klaus so eine wichtige Rolle spielt, steht auch für einen Umbruch der Erziehung in Deutschland, der im Osten einige Jahre früher stattfand als im Westen.
Ein echtes Lausbubenbuch, das die Zeit, in der die Geschichten handeln, sehr einfühlsam aus der Perspektive des kleinen Räubers erzählt, den auch der große Opa im fernen Norwegen nicht verleugnen möchte. Im Gegenteil. Die Großväter müssen ihre Geschichten weitergeben, findet er. Auch weil beide was draus lernen können – die neuen Lausbuben und die alten.
Was braucht der Mensch auf Erden? – Bernhard Künzner versucht’s mal in 30 Minuten …
So ungefähr zwei, drei Tage, auch wenn er sein Buch in lauter Minuten-Kapitelchen packt. Der Beginn ist ein Gedankenexperiment: Wie fühlt man sich, wenn man völlig nackt an einem leeren Sandstrand irgendwo weit weg von der Zivilisation landet? Wie fühlt sich das an in den ersten Minuten und dann ein bisschen später, wenn man gemerkt hat, dass man sich an so einem Strand nicht wirklich Gedanken um den Terminkalender des nächsten Tages machen muss? Aber natürlich merkt man da schon, wie tief unser durchorganisierter Alltag in uns sitzt, eng verwoben mit der permanenten Angst, Termine zu verpassen, Aufgaben zu vermasseln, den “Chefs” nicht zu genügen. Manche sind ja geradezu gehetzt von diesen Ängsten. Und ihre “Chefs” tun alles dafür, dass diese Angst nicht nachlässt.
Auch deshalb fahren viele Familien lieber in ein durchorganisiertes Hotel-Ressort als an einen einsamen Strand am Atlantik. Man ahnt schon, was passieren könnte.
Vitamin B 17: Eine andere Krebstherapie – aber auch ein paar Gedanken über das eigentliche Problem
Auf der Grenze zwischen Traum und Kindheit: Kleine schwebende Geschichten über Liebe, Teufel und das Beinah
Die Rückkehr des Wassermannzeitalters: Jorge auf der Suche nach der Weltenformel
Es ist, als käme die westliche Gesellschaft nach einem großen Umweg wieder zurück ins Wassermannzeitalter. All die großen Lösungsansätze der letzten Jahrzehnte haben sich als Fehler erwiesen. Der Mensch ist so ratlos wie zuvor – und entdeckt in den esoterischen Selbstfindungen der Eltern oder gar schon Großeltern eine Fluchtmöglichkeit aus dem nur noch als sinnlos zu interpretierenden Dilemma. Die Esoterik-Regale in den Buchhandlungen platzen aus den Nähten.
Selbst große Autoren der jüngeren Weltliteratur scheinen auf dem Sonnenweg zu sein – wie Paulo Coelho, den T. C. Wilde gleich mehrfach erwähnt in diesem Buch, in dem er seinen Helden Jorge auf die Suche nach sich selbst schickt. Dabei bereist der Leadgitarrist der erfolgreichen Band “The Emirates” das “Medizinrad”, das ihn fast um die ganze Welt führt – an alle möglichen Orte, die in der modernen Esoterik- und Schamanenliteratur immer wieder eine Rolle spielen: den Amazonas-Urwald, den eisigen Norden Alaskas, das okkulte Indien mit seinen Buddhas und Hippie-Kommunen, Afrika mit seinen geheimnisvollen Medizinmännern, und auch den europäischen Norden – im Norden Finnlands erlebt Jorge seinen Sonnentanz.
Der Autor verspricht nicht nur am Ende des Buches, dass er sich mit dieser Art Leben selbst identifiziert – er scheint es auch so zu leben: 1967 in Hessen geboren, ausgebildeter Lehrer, aber dann doch lieber Aussteiger, einer, der wie sein Buchheld auch mal eine Auszeit nimmt, um auf die Suche nach sich selbst zu gehen. Die Auszeit für dieses Buch hat er sich augenscheinlich irgendwo in der Stille Brandenburgs genommen.


Man ahnt so ein wenig, warum es die Leipziger Stadtverwaltung deshalb für so wichtig erachtet, die Leipziger Kreativszene in Kurse nach dem Motto “Wie manage ich mich selbst” zu stecken. Was natürlich wieder Blödsinn ist. Manager sind nicht kreativ. Das beißt sich. Und führt bestenfalls zu genau dem, womit der deutsche Kunst- und Musikmarkt sowieso schon überschwemmt ist: professionellem Müll, an dem ein paar Leute sich goldene Nasen verdienen.
Natürlich kann in so einem Roman nicht geklärt werden, wie wirklich kreative Leute aus der Misere herauskommen. Mittlerweile sind ja hunderte Romane zu diesem Thema entstanden. Das Drama beginnt in der Regel kurz nach dem Platzen der Blase – wenn der clevere Geschäftsmann sich ins Ausland verdrückt und das Finanzamt beim Künstler anruft und ihm andeutet, dass die Sache mit der Steuer für die zurückliegenden Jahre überhaupt noch nicht geklärt sei. Finanzämter behandeln Kreative wie Manager. Politiker mittlerweile auch. Das Problem wird sich also weiter verschärfen.

Das geht digital noch flotter als auf Papier. Mit mehr als 10.000 Autorinnen und Autoren aus 89 Ländern und über 100.000 Beiträgen wirbt die Plattform e-Stories.de, die für etwas ambitioniertere Autoren sogar Dienste im Lektorat und fürs Marketing anbietet. Seit er 19 war, ist der in der Nähe von Münster lebende Sebastian Brinkmann dort aktiv, veröffentlicht dort kurze Texte. Geboren ist er in Telgte. Da denkt man natürlich an Günter Grass’ “Treffen in Telgte”.
Die Schotten sind schuld: Ein Handbuch für professionelle Text-Arbeiter
Ralf Julke
Nudeln kochen kann der Bursche, der sich so einprägsam James Cook nennt. Doch wer nun ein Reisetagebuch in die Südsee von ihm erwartet hat, bekommt etwas, was verpackt ist wie ein flotter Jugend-Roman, aber keiner ist. Buchumschläge können irritieren. Aber wie verpackt man einen Roman, in dem der Held aus Zeit und Leben fällt?
Ein (Un-) Glück kommt selten allein von Sandra Panagl
Ralf Julke
Noch ein Mädchenbuch. Man staunt ja, was in Leipziger Verlagen so alles verlegt wird. In jüngster Zeit also vermehrt Bücher von Mädchen für Mädchen. Auch wenn die Mädchen in der Regel schon deutlich über 18 sind. In diesem Fall sogar noch ein wenig älter. Petra, Sybille und Kerstin sind alle drei eigentlich schon gestandene Frauen, erfolgreich im Beruf, im Haushalt und in der Bewältigung der üblichen Familiendramen.
Aber auch das kann ja noch kommen. Die wirklich guten Geschichten beginnen ja – frei nach Tucholsky – immer erst nach dem Abspann. Wenn man weiß, wer für die Beleuchtung zuständig war, die belegten Brötchen und den Stunt mit der Sahnetorte (kommt auch drin vor). Das Typische für Frauen- und Mädchenromane ist: Sie hören mit den vielen Taschentüchern beim Happyend auf. Irgendwie wollen Mädchen wohl wirklich nur das Eine: Dass alles, alles gut wird.
Und was sagt Theobald Tiger dazu? – “Na, un denn –?”
Hinterzimmerei von Vera Luchten
Ralf Julke
Ort der Handlung ist ein fiktives Städtchen irgendwo im Westen der Republik. Der Hans im Glück, der sich hier in der Politik versucht, heißt Heiner van der Velden, Dozent an der örtlichen Universität, Theologe und Suchender. Das passiert. Wer Ansprüche an sich und seine Welt hat, der möchte sich einbringen. Erfahrungen in einer Bürgervereinigung hat er schon gesammelt. Jetzt will er in die Politik, liest sich vorher genau die Parteiprogramme durch. Macht ja auch nicht jeder. Und dann stellt er den Mitgliedsantrag bei einer jener kleinen Parteien, die gern den Sprung in die Stadtparlamente, Land- und Bundestage schaffen wollen. Im Buch heißt sie schlicht die Partei.
 Hinterzimmerei
HinterzimmereiVera Luchten, Einbuch Verlag 2012, 14,90 Euro
Ich koche nie für zwei. Oder: James Cooks kleines Studinudelkochbuch
 www.einbuch-verlag.de“James Cooks kleines Studinudelkochbuch”, Einbuch Verlag, Leipzig 2011, 8,88 Euro
www.einbuch-verlag.de“James Cooks kleines Studinudelkochbuch”, Einbuch Verlag, Leipzig 2011, 8,88 EuroStrandtrift von Jo Hilmsen
Sieben rabenschwarze Geschichten von Jo Hilmsen: Strandtrift
Kumpane Räuber und Genossin von Norbert F. Schaaf
Kumpane, Räuber & Genossin: Ein turbulenter Roman über einen turbulenten Herbst
 www.einbuch-verlag.de Norbert F. Schaaf “Kumpane, Räuber & Genossin”. Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2011, 14,90 Euro
www.einbuch-verlag.de Norbert F. Schaaf “Kumpane, Räuber & Genossin”. Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2011, 14,90 EuroMondfahrt von Patrick Zschocher
Ein Roman mit Endzeit, Liebe und ganz unterschiedlichen Sichten: Patrick Zschochers “Mondfahrt”
 www.einbuch-verlag.de
www.einbuch-verlag.de
ARTIKEL
Verleger-Absage an Amazon: Patrick Zschocher streikt schon seit November

 www.einbuch-verlag.de
www.einbuch-verlag.deDer Brief von Christopher Schroer an Jeff Bezos:
 www.chsbooks.de/adieu-amazon/Das Interview mit Christopher Schroer in der “Zeit”:
www.chsbooks.de/adieu-amazon/Das Interview mit Christopher Schroer in der “Zeit”:  www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-02/interview-schroer
www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-02/interview-schroer
zu … nun MS von Christine Kollmann
„Ich dachte, ich stürze auf die Gleise“ Lesung Christine Kollmann aus Wildau lebt seit 1998 mit multipler Sklerose, nun hat sie darüber geschrieben
Erstlingswerk von Sandra Panagl ist da
HOHENEICH (pp). Sandra Panagl, eine zweifache Mutter und Hobbyautorin aus Hoheneich, präsentiert nun ihr erstes veröffentlichtes Buch. “Ein (Un-)Glück kommt selten allein” (ISBN 978-3-942849-06-7). “Es handelt von drei Frauen Anfang 40, die seit der Schulzeit eine gute Freundschaft pflegen. Drei Frauen mit ganz verschiedenen Lebensstilen und so manchen Ereignissen, die ihr doch so solides Leben auf den Kopf stellen”, meint die Autorin. Mehr zum Inhalt auf www.meinbezirk.at.
Das Schreiben liebte Sandra Panagl schon immer. Zuerst schrieb sie lange Zeit nur Kindergeschichten, doch nun ist sie auf “Erwachsenengeschichten” umgestiegen und hat in zwei Wintern ihr Erstlingswerk vollendet. Ohne Hintergedankten stellte sie eine Leseprobe ins Internet. Promt meldete sich ein kleiner Verlag aus Leipzig. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen.
INHALT:
Petra Fuchs, Sibylle Köhler und Kerstin Wallner – in der Schule
ein berüchtigtes Trio. Obwohl behauptet wird, dass
Freundschaften zu dritt nicht lange gut gehen, treffen sich die
drei auch noch zwanzig Jahre nach Schulschluss, und das ohne
Zickenkrieg – na ja, zumindest fast.
Die Welt bereisen und viel erleben wollten sie, bevor der Alltag
sie einholt. Das Hausfrauen- und Berufsleben so lange wie
möglich hinausschieben. Doch gekommen ist alles ganz
anders.
Zwanzig Jahre später ist aus der dicken Freundschaft eine
liebgewordene Bekanntschaft geworden. Alle drei sind solide
und der Alltag hat sie früher eingeholt als jemals geplant, aber
unglücklich ist keine darüber! Drei Frauenleben, komplett
verschieden aber doch jedes für sich langweilig genug, um mit
Sicherheit keinen Stoff für einen Roman zu liefern. Und knapp
vor dem vierzigsten Geburtstag hat man die wilden Jahre
ohnehin hinter sich und kann sich so richtig ausruhen und
ohne schlechtes Gewissen bieder sein. Gelassen die ersten
Falten und grauen Haare begrüßen.
Die Midlife-Crisis überlassen wir den Männern, wir Frauen
stehen da drüber, oder?
Doch gerade, wenn man sich an sein Leben gewöhnt hat und
eigentlich gar nichts mehr verändern will, kommt ein
Wirbelsturm und fegt alles wieder durcheinander. Ohne
Rücksicht auf das Alter, ohne Rücksicht auf Ehe, Freundschaft
und Liebe. Und plötzlich gibt es auch genug Stoff für einen
Roman. Tja, da bleiben auch Petra, Kerstin und Sibylle nicht
verschont.
Sie erzählen, wie das Schicksal ihr Leben auf den Kopf stellt –
oder sind es doch nur die Hormone, die plötzlich verrückt
spielen?
INTERVIEW
zu EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig
„GEGEN DEN WIND RAUS“
Ich bin gelernter Zimmermann, habe den Beruf inklusive Ausbildung ungefähr zehn Jahre, bis 1995 ausgeübt. Ich habe bei der Denkmalpflege Leipzig gearbeitet. Nach der Wende gab es zunächst gute Bedingungen als Zimmermann. Dann hat man angefangen, sämtliche Menschen in die Bereiche Bau und Handwerk umzuschulen. Als ich als Zimmermann nicht mehr gebraucht wurde, habe ich aufgehört.
Ich wollte immer eine Kneipe haben und habe diesen Wunsch dann 1997 in die Tat umgesetzt. In der Demmeringstraße habe ich das „Café Zschocher“ eröffnet.
Das Leben eines Gastwirtes war unerwartet anstrengend und nachdem ich diese Tür endgültig abgeschlossen hatte, brauchte ich ein gutes Jahr um wieder zu mir zu finden.
Ich habe ungefähr 2000 angefangen. Zunächst einfach aus einem unbestimmten Impuls heraus. Habe mir das dann selbst angeschaut und fand es nicht gut. Dann habe ich zunächst eine Weile nichts mehr geschrieben. Später hatte ich einen Traum. Was ich da geträumt hatte, war das Ende einer Geschichte. Diese Geschichte habe ich dann versucht zu schreiben. Heraus kam mein erster Roman. Das hat eine Zeit gedauert, und viele Mühen gekostet. Ein wirklich harter Prozess, denn über diesen ersten Roman habe ich das Schreiben autodidaktisch gelernt.
Das erste heißt: „Die Reise eines Träumers“, das aktuelle hat den Arbeitstitel: „Minus“. Dazwischen habe ich noch zwei andere Bücher geschrieben: „Mondfahrt“ und „Regen am See“. Also habe ich, in mittlerweile zehn Jahren vier Bücher geschrieben.
Ja. Mit dem ersten Buch bin ich damals zum Reclam in Leipzig gegangen. Dies war ein handschriftliches Manuskript. Das war wohl unüblich. Aber ich habe halt damals noch handschriftlich gearbeitet. Dort hat man auch mit mir gesprochen und es gab eine Weile die Hoffnung, auch eine Reaktion. Allerdings hat man mich dort, und später auch bei anderen Verlagen stets abgelehnt. Es ist einfach schwer als unbekannter Autor in Deutschland einen Verlag zu finden, der das Risiko dann auch trägt.
Genau. Ich habe mich entschlossen, den Verlag „EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig“ zu gründen. Der Verkauf findet (fast) ausschließlich über das Internet statt.
Derzeit arbeite ich mit Jo Hilmsen zusammen. Zur Buchmesse werden wir z. B. eine Lesung im Globus gegenüber der Leipziger Messe machen. Im April gibt es dann noch eine im „Noch Besser Leben“, auf der Karl-Heine-Straße. Eine Buchveröffentlichung von Jo Hilmsen im EINBUCH Verlag gibt es auch: Strandtrift – Sieben Geschichten.
Ich bin in Neu-Lindenau, also in einem recht begrünten bürgerlichen Umfeld aufgewachsen. In dem Bereich Lützner Straße, Plautstraße. Eine Wohngegend mit Bäumen, Innenhöfen und recht beschaulich. Plagwitz war damals ein Industriemoloch, alles dreckig, schwarz und neblig vom Rauch. Meine Schule war die 46., früher 146. Schule an der Saalfelder Straße. Später musste ich einmal nach Mockau ziehen. Dort hatte ich eine Wohnung bekommen. Das war sehr öde dort und darum bin ich nach der Wende sofort nach Plagwitz gezogen, in den Westen.
Ich war 20 Jahre. Ich habe zunächst aus der Ferne den Demos zugeschaut. Erst später bei der am 9. Oktober war ich selbst auch dabei. Das Motto war: „Wir bleiben hier“. Das entsprach mir nicht wirklich, denn ich wollte damals lieber ausreisen. Einen Ausreiseantrag hatte ich auch schon gestellt. Dabei hat mich die Regierung nicht wirklich gestört, die alten Männer. Lieber wäre ich aus dem Gefühl des „Eingesperrt seins“ heraus gekommen. Ich wollte nur einfach was anderes Sehen und ein nicht ganz so vorhersehbares Leben führen. Meine Lebensaussichten schienen mir damals nicht wirklich interessant.
Ja. Aber eigentlich nur kurz. Denn dann musste man nicht mehr weg, das Spannende passierte ja hier.
Wir sehen Dich fast immer auf einem Fahrrad. Nur ein Transportmittel?
Das Fahrradfahren ist mir wichtig. Das Fahren gibt mir Struktur. Ich fahre jeden Tag zwei bis drei Stunden. Gegen den Wind raus. Dann kann ich mit dem Wind wieder zurück kommen. Die Bewegung, die Luft, das brauche ich um in den Tag zu kommen. Nach meiner Zeit als Wirt brauchte ich etwas, um mich wieder fit zu machen. Da habe ich mit dem Fahrradfahren angefangen.
Alltag, die Arbeit, wie stellen wir uns das bei Dir vor?
Nach meinen Fahrradtouren gehe ich in mein Arbeitszimmer und setze mich an den Computer: Mails, Lesen, Schreiben und Telefonieren, so was halt.
Auch die Bücher?
Nein, wenn ich an einem Buch arbeite, dann erst am Abend.
http://www.verlagederzukunft.de/einbuch-buch-und-literaturverlag-leipzig/